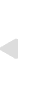I
The Roumanians and Their Language
Not many years ago, the Roumanians, i.e., the inhabitants of the two principalities of Moldavia and Wallachia, were hardly known by name, and it was only through the grave events of which the Lower Danube has been the scene, since the middle of the XIX. century that they are prominently brought to the fore. We know now that they constitute one of the most important elements of the population of Eastern Europe—that they differ essentially from their neighbors, be they Slav, Turk, or Magyar—and that in some way they are descendants of the old Romans, though they live detached from the other nations of the Graeco-Latin family.
The origin of this Latin-speaking nation is still shrouded in mystery. Are they the descendants of the Getae and Latinised Dacians? Or does the blood of Italian colonists brought thither by Emperor Trajan (98-117 A.D.) predominate among them?
The Roumanians of to-day are anxious to purge their language of all Servian, Greek, and Turkish words introduced during the long dominion of the Turks. They endeavor to polish their tongue so that it may rank with Italian, to which it is closely related. About one half of the words of the Roumanian language—as spoken between the Lower Danube and the Carpathian Mountains—are Latin, while the roots of the other constituent elements must be looked for in Slavic, Albanesian, Greek, Hungarian, Turk, and German. There remain, however, several hundred words not traceable to any known tongue, and these are supposed to be a remnant of the ancient Dacian spoken on either bank of the Lower Danube at the period of the Roman invasion, in the beginning of the second century after Christ.
II
“Carmen Sylva,” Roumania’s Poet-queen
In the opening lines of her collection of poems, Carmen Sylva, Roumania’s poet-queen, describes to us whence she derived her euphonious self-chosen title: Carmen—the “Song”—which gave her happiness and ease, and Sylva—the “Wood,”—in which, among the birds, she had learned to sing. The telling of stories in prose and verse has been her greatest delight since she was a child.
Queen Elisabeth of Roumania is a daughter of Prince Hermann of Neuwied, and was born on the 29th of December, 1843. Neuwied was a small principality on the bank of the Rhine, near Ehrenbreitenstein, and her family was an old and honored one, living at the castle of “Monrepos,” a short distance from the quaint old town of Neuwied, on that part of the Rhine, where every rocky height has its romance, and every green valley its legend. In her early youth, the village-children were the only playmates of the little princess. When a mere child she developed a poetic taste and talent. At nine she began to write. At sixteen her tasks were long and severe: She studied history, the languages (Latin, Italian, French, and English), grammar, arithmetic, geometry, and literature, and read poetry, history, and the drama for recreation. From eighteen to twenty-four she studied, traveled and taught the poor. She had both talent and inclination for teaching, and was actually preparing herself for a school-teacher’s position, when the marriage with the Prince of Roumania prevented her from carrying out her plan.
In 1866, Prince Karl of Hohenzollern had been placed upon the throne of Moldo-Wallachia by the European powers, with the title as Prince of Roumania. He proved himself an efficient and energetic ruler, and his popularity was soon so well founded that he was induced to go out a-wooing, so as to be able to insure the perpetuation of his race to the principality. In earlier years he had met Princess Elisabeth of Neuwied at the Court of Berlin, and he there almost saved her life. She was descending the stairs when her foot slipped, and no one knows what the result might have been, had not the gallant prince, then a handsome young lieutenant, caught her in his arms and saved her. Be this as it may, when the princess and her mother were in Cologne, in 1868, Prince Karl, then Prince Carol I. of Roumania, paid them a visit. “What a handsome fellow he has grown to be!” exclaimed Princess Elisabeth. “Yes,” replied her mother, “and he is here for the purpose of asking for your hand.” “He is a man whom everyone must admire,” answered the princess, and on the following day her betrothal to the young ruler on the Lower Danube was officially announced. In November, 1869, they were married, and on the 22d of the same month, Princess Elisabeth first trod Roumanian soil and was received by thousands upon thousands of the people, who sang to her the Roumanian hymn as welcome and greeting. With Prince Carol she was supremely happy; he worshipped her and declared that she was his better self. A little daughter was born to them, but after a few short years of happy motherhood the Queen bowed in anguish over a tiny grave, in which she felt that all her hopes were buried.
It was then, that she made the decision thenceforth to labor for the good of the children of her adopted country, to unveil to them the treasures of folk-lore that existed among the dwellers of the Carpathian Mountains, and to do her part in educating them in patriotism by the narration of simple stories of Roumanian peasant-life and peasant-fidelity. The royal heart that had lost its own child, went out and sought to make the children of a nation its own, and succeeded. Year after year, from her beautiful castle in the Carpathians, where the wild Pelesch in its calmer moods whispers to her its stories, the poet-queen has devoted herself to writing for the benefit of her Roumanian child-subjects, and with each year she has drawn the bond of sympathy between her husband—who in 1881 had been proclaimed King of Roumania—and his people closer and surer.
The Queen’s best-known book, “Aus Carmen Sylva’s KÖnigreich” had its origin in this wise: In the spring of 1882, the Roumanian Minister of Public Instruction asked Her Majesty, if she would not deign to write a book that could be used in the public schools of the kingdom as a prize-book to be given to the best scholars at the close of the year’s work. To this request the Queen readily consented and the result was the delightful stories and legends from the mountains and valleys around her home in the Carpathians with illustrations by her own hand. They were written in German and translated into Roumanian. From this book, the present volume contains a selection of those tales, which, the Editor thinks, may prove the most interesting to young English and American readers.
The special charm of “Carmen Sylva’s” stories is their sweet simplicity of thought and language, their freedom from all conventional methods and their homely beauty.—Supplemented by grammatical and explanatory Notes and a complete Vocabulary, these “Tales from Carmen Sylva’s Kingdom” are expected to make an excellent and charming reading book, which advantageously might be put into the hands of beginners as early as the second half of the first year of their study in German, while for reading at sight the text would be most suitable for second and third year students.
Washington, D.C., October, 1899.