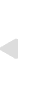An einem heißen Sommertage flog eine neugierige Fliege durch das offene Fenster in die Schulstube. Da hÖrte sie die Kinder das schÖne Lied singen: »Summ, summ, summ, Die Esel sind recht dumm.« Sie lernte es auch bald und dachte bei sich: »Nun habe ich viel gelernt und kann mehr als alle meine Verwandten. Jetzt will ich in die weite Welt ziehen und den Tieren Gesangstunden geben.« Sie flog hinaus auf die Wiese, wo ein alter Esel weidete. Sogleich dachte sie: »Das kommt mir wie gewÜnscht«, setzte sich auf den RÜcken des Esels und begann zu singen. »Was singst du da?« fragte der Esel. »Summ, summ, summ, Die Esel sind recht dumm.« »Das klingt hÜbsch«, sagte der Esel. »Ich denke, daß ich es jetzt auch kann, und weil du mich das schÖne Lied gelehrt hast, so will ich dir zeigen, wie du viel schneller fliegen kannst Nun kam sie an einen Bach und setzte sich auf einen Grashalm am Ufer. Ein Fisch schwamm heran, und als sie ihn erblickte, begann sie zu singen: »Summ, summ, summ, Die Fische — die sind stumm.« Da spritzte der Fisch so viel Wasser auf die Fliege, daß sie beinahe ertrank und nur mit MÜhe weiterfliegen konnte. Gegen Abend begegnete sie einer Ente und begann zu singen: »Summ, summ, summ, Die Enten gehen krumm.« Da sagte die Ente: »Ei, das klingt recht hÜbsch, nur verstehe ich es nicht recht, denn ich bin ein wenig taub. Komm nÄher und sing das Lied noch einmal, damit ich es auch lerne!« Die Fliege flog heran, setzte sich vor die Ente und begann zu singen: »Summ, summ, summ, Die Enten gehen krumm.« Da, auf einmal — klaps! Die Ente hatte die gelehrte Fliege verschluckt. Eines Tages kam der Fuchs auf eine Wiese und sah, wie ein Krebs »Wie schnell du lÄufst!« sagte er spÖttisch. »Ich sehe, du gehst noch besser rÜckwÄrts als vorwÄrts. Wann gedenkst du Über die Wiese zu kommen?« Der Krebs aber merkte wohl, daß der Fuchs ihn nur verspotten wollte. Deshalb antwortete er: »Ich sehe, daß du meine Natur nicht kennst. Ich wette zehn Mark, daß ich schneller laufe als du.« »Gewiß,« sagte der Fuchs, »die Wette gefÄllt mir. »O nein,« sprach der Krebs, »das wÄre uns beiden zu weit. Laß uns eine gute Meile laufen, das ist genug, und ich gebe dir auch noch einen Vorsprung von der ganzen LÄnge deines eigenen KÖrpers, vom Kopf bis zum Schwanz. Was sagst du dazu?« »Das gefÄllt mir noch besser!« sagte der Fuchs und lÄchelte wieder spÖttisch. »Sage also, wie wir’s am besten machen!« »Die Sache ist sehr einfach«, antwortete der schlaue Krebs. »Du trittst vor mich, und ich trete hinter dich, so daß deine Nun drehte sich der Fuchs um, bis er ganz dicht vor dem Krebs stand. Dieser aber faßte mit seinen Scheren den buschigen Schwanz des Fuchses, und als er merkte, daß der Fuchs es gar nicht fÜhlte, rief er laut: »Los!« Da lief der Fuchs so schnell, wie er in seinem ganzen Leben noch nicht gelaufen war. Endlich kam er ans Ziel, drehte sich rasch um und rief: »Wo ist nun der dumme Krebs? Wo bist du, Krebslein? Hahaha!« Der Krebs aber, der dem Ziele jetzt nÄher stand als der Fuchs, antwortete ruhig: »Hier! Wie langsam du lÄufst! Ich warte hier schon eine ganze Weile auf dich!« Da erschrak der Fuchs und sprach: »Dir muß der Kuckuck geholfen haben!« Dann zahlte er seine Wette, nahm den Schwanz zwischen die Beine und ging beschÄmt davon. Ludwig Bechstein. Es lebte einmal ein sehr armer Mann, der hieß Klaus. Dem hatte Gott großen Reichtum beschert, der ihm große Sorge machte, nÄmlich zwÖlf Kinder, und es dauerte nicht Nun war der erste, den er traf, ein freundlicher Mann von stattlicher Gestalt, nicht jung und nicht alt, und es schien dem Armen, als ob sich vor diesem Mann alle BÄume und Blumen und Grashalme tief verneigten. Da glaubte er, das mÜsse der liebe Gott selber sein, nahm schnell seine MÜtze ab, faltete die HÄnde und betete ein Vaterunser. Und es war auch der liebe Gott, der wußte schon, was Klaus wollte, und sprach: »Du suchst einen Paten fÜr dein Kindlein! Wohlan, ich will es dir aus der Taufe heben.« »Du bist allzu gÜtig, o Herr,« antwortete Klaus, »aber ich danke dir. Du gibst denen, welche haben, dem einen GÜter, dem andern Kinder, und so fehlt es oft beiden am Besten: der Reiche hat vollauf zu essen, und der Arme hungert.« Da wandte sich der Herr und ward nicht mehr gesehen. Klaus ging eine Strecke weiter, und bald kam ein Kerl auf ihn zu, der sah nicht nur aus wie der Teufel, sondern war es auch und fragte Klaus, wen er suche. »Einen Paten fÜr mein Kindlein«, war die Antwort. »Ei,« sagte jener, »so nimm mich, ich will es reich machen.« »Wer bist du denn?« fragte Klaus. »Ich bin der Teufel.« »Der Teufel!« Da wandte sich der Teufel und ging fort, indem er gegen den Armen ein abscheuliches Gesicht machte und die Luft mit Schwefelgestank erfÜllte. Hierauf begegnete dem Kindesvater wiederum ein Mann, der war so dÜnn und dÜrr wie eine Bohnenstange und klapperte beim Gehen. Der fragte auch: »Wen suchst du?« und bot sich zum Paten des Kindes an. »Wer bist du?« fragte Klaus wieder. »Ich bin der Tod«, sprach jener mit heiserer Stimme. Da war Klaus zu Tode erschrocken, doch dachte er, bei dem wÄre sein SÖhnchen vielleicht am besten aufgehoben, und sagte: »Du bist der Rechte. Arm oder reich, du machst alle gleich. Komm nur zu rechter Zeit, am Sonntag soll die Taufe sein.« Und am Sonntag kam richtig der Tod und ward Taufpate des Kleinen, und der Junge wuchs frÖhlich heran. Als er nun in die Jahre kam, wo er etwas erlernen sollte, damit er kÜnftig sein Brot verdiene, erschien der Pate und nahm ihn mit sich in einen finsteren Wald. Da standen allerlei KrÄuter, und der Tod sprach: »Jetzt sollst du als Patengeschenk das rechte, wahre Heilkraut von mir empfangen, und dadurch sollst du ein Doktor Über alle Doktoren werden. Doch merke wohl, was ich dir sage! Wenn man dich zu einem Kranken ruft, wirst du allemal Es dauerte nicht lange, so wurde er berÜhmt. Man sagte, er sei der grÖßte Arzt auf Erden, denn sobald er die Kranken nur ansehe, wisse er, ob sie leben oder sterben wÜrden. Und so war es in der Tat. Nun geschah es, daß der Wunderarzt in ein Land kam, dessen KÖnig schwer krank lag. Die HofÄrzte hatten alle Hoffnung aufgegeben. Weil aber KÖnige nicht lieber sterben als andere Menschen, so hoffte der kranke KÖnig dennoch, der Wunderdoktor werde ihn wieder gesund machen. Er ließ ihn also rufen und versprach ihm großen Lohn. Der KÖnig hatte aber eine Tochter, die war so schÖn und so gut wie ein Engel. Als der Arzt in das Schlafzimmer des KÖnigs trat, sah er zwei Gestalten an dessen Lager stehen, zu HÄupten die schÖne, weinende KÖnigstochter, zu FÜßen den kalten Tod. Und die KÖnigstochter bat ihn gar rÜhrend, den geliebten Vater zu retten, aber die Gestalt des finsteren Paten wollte nicht von der Stelle weichen. Da sann der Doktor auf Dieser hatte aber die reizende Prinzessin liebgewonnen, und auch sie schenkte ihm ihr Herz aus inniger Dankbarkeit. Aber bald darauf erkrankte sie schwer, und der KÖnig versprach, wer sie gesund mache, der solle sie zur Frau haben und nach ihm KÖnig werden. Da eilte der JÜngling zu der Kranken, sah aber zu ihren FÜßen stehen — den Tod. Noch einmal Übte er dieselbe List wie bei dem KÖnig, so daß die Prinzessin wiederauflebte und ihn dankbar anlÄchelte. Aber der Tod warf einen tÖdlichen Haß auf den JÜngling, faßte ihn mit eiserner, eiskalter Hand und fÜhrte ihn hinweg in eine weite, unterirdische HÖhle. In dieser brannten viel taufend Kerzen, große und kleine. Einige hatten gerade angefangen zu brennen, andere wollten schon ausgehen. »Sieh nun,« sprach der Tod zu seinem Paten, »hier brennt eines jeden Menschen Lebenslicht. Die ganz großen sind die Kinder, die halbgroßen die Leute, welche in den besten Jahren stehen, und die kleinen die Alten; aber auch das Licht eines Kindes brennt oft frÜh aus.« »Zeige mir doch meines!« bat der Arzt den Tod, und dieser zeigte auf ein ganz kleines StÜmpfchen, welches schon »Dann setze doch gleich das alte auf ein neues!« bat der JÜngling. »Wohlan, das will ich tun«, erwiderte der Tod, nahm ein langes Licht und tat, als ob er ihm das StÜmpfchen aufstecken wollte. Dabei aber stieß er mit Willen das kleine um, so daß es ausging. In demselben Augenblick fiel der Arzt um und war tot. Wider den Tod ist nÄmlich kein Kraut gewachsen. Ludwig Bechstein. Im StÄdtchen JÜterbog hat einmal ein Schmied namens Peter gelebt, von dem erzÄhlen die Alten den Jungen noch heutzutage ein seltsames MÄrchen. Dieser Schmied hatte nÄmlich als junger Bursche einen sehr strengen Vater und hielt Gottes Gebote treulich. Er machte große Reisen und erlebte viele Abenteuer. Dabei war er in seinem Handwerk ungemein tÜchtig und geschickt. Unter anderm besaß er eine Salbe, welche jeden Harnisch undurchdringlich machte, der damit bestrichen wurde. Im Heere Kaiser Friedrichs des Rotbarts wurde er oberster Da wÜnschte sich der Schmied folgendes: »Erstens, weil mir die Diebe so oft meine Birnen stehlen, so soll fortan keiner, der auf den Baum steigt, ohne meinen Willen wieder heruntersteigen kÖnnen; und zweitens, weil ich auch Öfters in meiner Stube bestohlen worden bin, so soll niemand ohne meinen Willen in die Stube kommen kÖnnen, außer durchs SchlÜsselloch.« Bei jedem dieser tÖrichten WÜnsche warnte das MÄnnchen: »Peter, Peter, vergiß ja das Beste nicht!« Da tat der Schmied den letzten Wunsch: »Drittens, das Beste ist ein guter Schnaps; also wÜnsche ich, daß meine Flasche niemals leer werde!« »Deine WÜnsche sind gewÄhrt«, sprach das MÄnnchen, strich im Weggehen mit der Hand Über einige Stangen Eisen, die in der Schmiede lagen, setzte sich auf seinen Esel und ritt weiter. Das Eisen war aber in blankes Silber verwandelt. Nun war der arme Schmied wieder reich und lebte fort und fort bei guter Gesundheit, denn der Trank in der Flasche war, ohne daß er es wußte, ein Lebenselixier. Endlich klopfte der Tod an seine TÜr, der ihn so lange verschont hatte. Peter war scheinbar auch bereit, mit ihm zu gehen, bat ihn aber erst um eine kleine Gunst. »Sei doch so gut,« sagte er zu dem Tod, »und hole mir ein paar Birnen von dem Baum! Ich selber bin zu alt und schwach hinaufzusteigen.« Der Tod stieg auf den Baum, und der Schmied sprach: »Bleib oben!«, denn er wollte gern noch lÄnger leben. Der Tod fraß alle Birnen vom Baum, dann mußte er fasten, und vor Hunger verzehrte er sich selbst mit Haut und Haar. Daher kommt es auch, daß er jetzt nur noch ein scheußliches, dÜrres Gerippe ist. Auf Erden aber starb niemand mehr, weder Mensch noch Tier. DarÜber entstand viel Unheil, und endlich ging der Schmied zu dem dÜrren, klappernden Tod und machte mit ihm aus, daß er ihn fortan in Ruhe lassen solle. Dann ließ er ihn laufen. WÜtend floh der Tod von dannen und begann wieder sein Darauf lebte der Schmied von JÜterbog noch lange Zeit in Ruhe und Frieden, bis alle seine Freunde und Bekannten gestorben waren und er selbst des Erdenlebens mÜde wurde. Er machte sich deshalb auf den Weg nach dem Himmel und klopfte ganz bescheiden ans Tor. Da schaute der heilige Petrus heraus, und Peter der Schmied erkannte in ihm seinen Schutzgeist, der ihn oft aus Not und Gefahr errettet und ihm zuletzt die drei WÜnsche gewÄhrt hatte. Jetzt aber sprach Petrus zu ihm: »Hebe dich weg von hier, der Himmel bleibt dir verschlossen; du hast das Beste zu wÜnschen vergessen, nÄmlich die ewige Seligkeit!« Da wandte sich Peter und gedachte, sein Heil in der HÖlle zu versuchen, und fand auch bald den breiten Weg dahin. Wie aber der Teufel hÖrte, daß der Schmied von JÜterbog Der Schmied von JÜterbog. Da nun der Schmied weder im Himmel noch in der HÖlle Zuflucht fand und es ihm auf Erden gar nicht mehr gefallen wollte, so stieg er in den KyffhÄuserberg hinab zu Kaiser Friedrich, dessen RÜstmeister er einst gewesen war. Der Kaiser freute sich ungemein, einen so treuen Diener wiederzusehen, und fragte ihn sogleich, ob die alten Raben noch um den Berg flÖgen. Und als Peter das bejahte, seufzte der Rotbart. Der Schmied aber blieb bei dem Kaiser im Berge, wo er dessen Lieblingspferd und auch die Pferde der Prinzessinnen beschlÄgt, bis einst die Raben nicht mehr um den Berg fliegen und die Stuude der ErlÖsung schlÄgt. Das wird geschehen, so glaubt das Volk, wenn anf dem Ratsfelde beim KyffhÄuser ein dÜrrer, abgestorbener Birnbaum wieder zu grÜnen und blÜhen beginnt. Dann tritt der Kaiser mit all seinem Gefolge hervor, schlÄgt die große Befreiungsschlacht und hÄngt seinen Schild an den grÜnen Baum. Hierauf begibt er sich mit all den Seinen zur ewigen Ruhe. Ludwig Bechstein. In Ostfriesland herrschte nach dem SiebenjÄhrigen Kriege große Not unter dem Volk. Die Franzosen hatten Nun wohnte dort zu jener Zeit, und zwar nicht weit von der hollÄndischen Grenze, ein armer Mann mit seiner Frau in einer kleinen LehmhÜtte. Beide waren fleißig und sparsam. Als aber die kalten Wintertage kamen, stieg ihre Not aufs hÖchste. Da hatte der Mann eines Morgens einen seltsamen Traum gehabt und sagte zu seiner Frau: »Ich gehe heute nach Emden. Mir hat nÄmlich getrÄumt, daß ich da auf der BrÜcke vor dem Rathaus mein GlÜck machen werde. Was sagst du dazu?« »TrÄume sind SchÄume,« antwortete die Frau, »aber du kannst es ja versuchen. Vielleicht findest du dort Arbeit, wenn du auch nicht reich wirst.« Der Mann zog also feinen wÄrmsten Rock an und ging nach Emden, wo er zeitig auf der RathausbrÜcke anlangte. Es war ein bitterkalter Tag, und niemand kÜmmerte sich um ihn, wie er da von Morgen bis Abend auf und ab ging. Schon wollte die Sonne sinken, und mit ihr seine Hoffnung, da trat ein Ratsherr an ihn heran nnd sagte: »Lieber Mann, ich sehe, Ihr geht hier den ganzen Tag auf der BrÜcke hin und her und haltet Euch selbst und den Weg warm. Erwartet Ihr jemand?« »Ja und nein«, antwortete der Mann und erzÄhlte dem Ratsherrn seinen Traum. »TrÄume sind SchÄume!« sprach dieser. »Wer das nicht glaubt und sein Bett verkauft, der liegt bald nackt und kalt im Stroh. Ich hatte einmal einen Ähnlichen Traum. ‚Du mußt‘, so trÄumte mir, ‚Über die Ems gehen und dich so und so wenden, erst rechts, dann links. Dann kommst du an einen Kreuzweg; an dem Kreuzweg steht ein HÄuschen, vor dem HÄuschen steht ein Birnbaum, und unter dem Birnbaum liegt ein Schatz begraben.‘ Aber meint Ihr, daß ich daran glaubte? ‚TrÄume sind SchÄume‘, sagte ich mir und dachte nicht weiter daran.« »Kann wohl sein, Herr, kann wohl sein,« sagte der Mann, »ich will deshalb auch lieber heimgehen. Guten Abend, Herr!« »Guten Abend und glÜckliche Reise!« sprach der Ratsherr. Der Arme ging anfangs langsam dahin, aber je weiter er kam, desto schneller wurde sein Schritt, bis er zuletzt fÖrmlich lief und schweißtriefend vor seiner LehmhÜtte anlangte. Seine Frau saß mittlerweile am Herd und wartete auf ihn. Auf dem Herd stand ein Topf voll Kartoffeln, die kochten schon, »Nun setz’ dich und iß erst, dann erzÄhle!« sagte sie. »Jetzt essen?« erwiderte er. »Dazu haben wir keine Zeit. Hole mir Spaten und Laterne, dann komm mit und hilf mir graben!« Obgleich die arme Frau fast befÜrchtete, ihr Mann sei von Sinnen, so tat sie doch, was er ihr befohlen hatte, und in nicht gar langer Zeit fanden die beiden SchatzgrÄber unter dem Birnbaum einen irdenen Topf voll Geld! An dem Kreuzwege wurde bald darauf ein neues, freundliches HÄuschen gebaut. Die Bewohner hatten nicht nur ihr gutes Brot, sondern halfen auch andern Leuten gern, wenn es not tat. Im Hause aber stand auf dem Schrank der irdene Topf mit einer Schrift daran, die weder der Mann noch die Frau lesen konnte. Da wurde es wieder einmal Herbst. Es hatte stark geregnet, und die Wege waren grundlos geworden. Ein hollÄndischer Pfarrer trat ins Haus und fragte die guten Leute, ob er sich ein wenig bei ihnen ausruhen dÜrfe. Sein Wagen, sagte er, stecke nicht weit davon in dem weichen Lehmboden, und es werde wohl eine Stunde dauern, bis der Kutscher weiterfahren kÖnne. Der Herr Pastor wurde natÜrlich gebeten, den Ehrenplatz am Herde einzunehmen. Er ließ sich in den großen Lehnstuhl nieder und streckte die kalten FÜße gegen das Herdfeuer. Wie er nun so dasaß, fiel ihm der irdene Topf oben auf dem Schrank in die Augen, und er fragte, was daran geschrieben stehe. Die Leute erzÄhlten ihm, der Topf sei ein altes ErbstÜck, doch die Schrift kÖnnten sie nicht lesen. Der Pfarrer trat an den Schrank, besah das GefÄß von rechts und von links und sagte: »Nun, lesen kann ich die Der Mann und die Frau sahen einander an, als wenn sie sagen wollten: »Wir aber wissen’s jetzt«; doch ließen sie den Pfarrer nichts merken. Mittlerweile war der Kutscher gekommen und meldete dem Pfarrer, er kÖnne nun weiterfahren, der Wagen stehe vor der TÜr, und damit nahm der fremde Herr Abschied. Am Abend desselben Tages hoben Mann und Frau noch den zweiten und grÖßeren Schatz, und auch damit haben sie in den Zeiten, wo das Land unter der Herrschaft Napoleons seufzte, recht viel Gutes getan. T. Kerkhoff. Ein reicher Bauer stand in seiner Scheune und schaute zufriedenen Herzens an, was ihm der Sommer und der Herbst gebracht hatten. Bis zum hohen Giebel hinauf war alles voll goldener Garben, und draußen auf dem Felde standen noch Hunderte, so reich war die Ernte gewesen. Dazu war das Stroh so lang und die Ähren so voll wie seit Jahren nicht. »Nun, was willst du denn, kleiner Mann?« fragte der. »Wolltet Ihr wohl die GÜte haben,« sprach der Zwerg, »mir tÄglich um diese Zeit eine GerstenÄhre zu schenken? Es soll nicht zu Eurem Schaden sein.« Der Bauer, der wohl wußte, daß man gegen solch kleines Volk freundlich sein muß, sprach: »Gewiß, das soll geschehen. Kommt nur immer um die Mittagsstunde her, dann gebe ich Euch gern, was Ihr begehrt.« Damit trat er ein wenig beiseite, zog aus einer der Garben eine schÖne GerstenÄhre hervor und reichte sie dem MÄnnlein. Das wandte sich mit nachdenklicher Miene gegen den Haufen Stroh, aus dem es hervorgekommen war, und sprach: »Ihr habt diesen großen Berg vor unsere HÖhle geschoben. Wenn er da liegenbleibt, so kann ich mit Eurer freundlichen Gabe nicht in unsere Wohnung zurÜck.« »Ist es weiter nichts?« sagte der Bauer und schob mit dem Fuß das Stroh beiseite. Es zeigte sich nun unten an der Wand eine Öffnung so groß wie ein Mauseloch. Das Wichtlein lÜftete wieder sein KÄppchen, dankte dem Bauer, nahm die schwere GerstenÄhre auf die Schulter und schleppte seine Last unter lautem Schnaufen davon. Den langen Halm in das Loch hineinzubringen, war ihm keine leichte Arbeit, und es dauerte wohl eine halbe Minute, bis der letzte Zipfel in der Öffnung verschwunden war. Der Bauer ging von nun an alle Mittage in die Scheune und gab dem Zwerg seine GerstenÄhre, und von dieser Zeit an gedieh sein Vieh auf eine wunderbare Weise, obgleich es weniger Futter und Pflege verlangte als sonst. Es war eine wahre Lust, die runden, fetten Schweine anzuschauen, die kaum aus den Augen sehen konnten und sich nur mit MÜhe an den Futtertrog schleppten. Solch blanke KÜhe wie auf seinem Hofe fand man weit und breit nicht. Sie gaben die fetteste Milch, und die Butter verkaufte die BÄuerin zu den allerhÖchsten Preisen. Auch die Pferde, die doch tÄglich nur einige Handvoll Hafer und ein wenig Heu bekamen, waren glatt und schÖn und zogen Pflug und Wagen doppelt so gut als frÜher. Ähnlich ging es mit den HÜhnern: sie legten fast das ganze Jahr hindurch, und manchmal sogar Eier mit zwei Dottern darin. Dies alles gefiel dem Bauer und der BÄuerin gar wohl, und da sie recht gut wußten, wem sie den Segen zu ver Eines Tages im Winter aber, als es draußen Stein und Bein fror, saß der Bauer allzu behaglich in seinem Lehnstuhl am warmen Ofen und wartete auf das Mittagessen. Jedesmal, wenn die TÜr aufging, roch er schon sein Lieblingsgericht, nÄmlich Schweinsbraten mit Äpfeln und Pflaumen, Dieser, ein vorwitziger Mensch, hatte schon lange gewÜnscht, das seltsame MÄnnchen zu sehen, von dem man sich im Dorfe die wunderlichsten Dinge erzÄhlte. Und als er nun dem Wichtlein den Halm reichte, kitzelte er es ein wenig damit unter der Nase, so daß es ein possierliches Gesicht machte und anfing zu niesen. DarÜber wollte sich der Knecht totlachen. Als aber der Zwerg sich mÜhte, die GerstenÄhre in das Loch hineinzuschleppen, rief der grobe Kerl: »Nun seht doch, wie das kleine Ding zieht und zerrt, als ob der Halm ein Baum wÄre!« Kurz, er verhÖhnte das MÄnnlein auf alle Weise. Dieses aber ward im Gesicht so blutrot wie seine MÜtze und warf zornige Blicke um sich. Am andern Tage, als der Bauer wieder selbst kam, um dem Wichtlein die Ähre zu geben, wartete er vergebens: es erschien niemand. Er rief es mit schmeichlerischen Worten Von nun ab ging alles auf dem Hofe den Krebsgang. Die Pferde, KÜhe und Schweine fraßen ganze Berge von Futter auf, waren aber immer hungrig und wurden immer magerer. Den Pferden konnte der Bauer seinen Hut auf die HÜftknochen hÄngen, wenn er gewollt hÄtte, und ziehen wollten sie gar nicht mehr, weder Pflug noch Wagen. Die KÜhe gaben nur noch die dÜnnste, blauste Milch, und an Verkauf von Butter war nicht mehr zu denken. Die Schweine rannten magerer als Windhunde unter den EichbÄumen umher, und die HÜhner kriegten den Pips und legten Windeier, oder wenn sie einmal ein ordentliches Ei legten, so fraßen sie es selbst auf. Wie oft hat der Bauer bereut, daß er damals nicht selbst hinausgegangen ist, um dem Zwerglein die gewohnte GerstenÄhre zu reichen! Aber die Reue kam zu spÄt. Er hat denn auch schließlich all sein Hab und Gut mit großem Schaden verkauft und ist ins Ausland gezogen. Heinrich Seidel. Der Zwerg und die GerstenÄhre. In Kleve ritt einmal ein reicher hollÄndischer Kaufmann in einem Gasthof ein und bestellte sich zwÖlf gekochte Eier. Als sie ihm aber gebracht wurden, konnte er sie nicht verzehren, weil eben ein Eilbote eintraf und ihn in einer dringenden Angelegenheit heimberief. Also verließ er sogleich das Haus, sprang wieder auf sein Pferd und ritt fort, ohne die Eier bezahlt zu haben. Zehn Jahre spÄter jedoch kehrte der Kaufmann wieder in demselben Gasthof ein. Da sagte er zu dem Wirt: »Ich schulde Euch noch das Geld fÜr die Eier, die Ihr mir vor zehn Jahren kochen ließet. Wie groß ist die Summe?« »Ja,« sagte der Wirt, »die werden Euch teuer genug zu stehen kommen, Herr.« »Nun,« meinte der Kaufmann, »ich werde doch wohl ein Dutzend Eier bezahlen kÖnnen!« »Das ist eben die Frage«, entgegnete der Wirt. »Aber Ihr werdet ja sehen. Kommt nur morgen aufs Gericht, denn ich habe Euch lÄngst verklagt.« Der Kaufmann weigerte sich auch nicht. Und als sie nun am nÄchsten Morgen vor den Richter kamen, rechnete ihm der Wirt vor, aus den zwÖlf Eiern wÜrden zwÖlf KÜchlein gekommen sein, und die KÜchlein wÜrden wieder Eier gelegt haben, aus welchen wieder KÜchlein gekommen sein wÜrden, und so fort, zehn ganze Jahre lang, was Ganz niederschlagen verließ der reiche Herr den Gerichtssaal, denn er sah nun Armut und Not leibhaftig vor Augen. Da begegnete ihm ein altes MÄnnlein, das sprach: »Herr, was habt Ihr Trauriges erlebt? Ihr seht ja aus wie die teure Zeit!« »Ach,« seufzte der Kaufmann, »wozu soll ich Euch das alles erzÄhlen? Ihr kÖnnt mir doch nicht helfen.« »Wer weiß?« versetzte der Alte. »Ich bin ein guter Ratgeber. Laßt hÖren!« Nun erzÄhlte ihm der Kaufmann die ganze Geschichte, und das MÄnnlein sprach: »Wenn es weiter nichts ist, so geht nur gleich zum Richter und sagt ihm, die Sache mÜsse noch einmal verhandelt werden, denn Ihr hÄttet einen Rechtsanwalt gefunden. Dann will ich kommen und Euch beistehen.« »Wenn Ihr das fertigbringt,« sagte der Kaufmann erleichterten Herzens, »so will ich Euch sechshundert Gulden geben!« »Das wird sich finden«, meinte das MÄnnchen. »Geht nur gleich hin!« Das tat der Kaufmann, und der Richter setzte einen Tag fest, wo die Sache aufs neue zur Verhandlung kommen und er mit seinem Anwalt erscheinen solle. Als nun der Gerichtstag kam, war der HollÄnder zeitig genug da, aber das MÄnnlein kam nicht. Die Gerichtsherren hinter dem grÜnen Tische fragten schließlich den Kaufmann, wo denn sein Rechtsanwalt sei; die Stunde sei fast vorbei, nach deren Verlauf sie das erste Urteil bestÄtigen mÜßten. Da endlich erschien das MÄnnchen, und die Richter wollten wissen, warum er denn so lange ausgeblieben sei. »Ich habe erst Erbsen kochen mÜssen«, antwortete das MÄnnchen. »Was habt Ihr denn mit den Erbsen machen wollen?« fragten die Richter neugierig. »Die habe ich pflanzen wollen«, gab der Alte zur Antwort. »Ei,« lachten die Herren, »gekochte Erbsen pflanzt man doch nicht, sonst kommen ja keine FrÜchte!« »Und von gekochten Eiern«, fiel das MÄnnchen ein, »wÄren auch keine KÜchlein gekommen! Darum seid so gut, ihr Herren, und sprecht dem Mann hier ein anderes Urteil, denn dieser schuldet dem Wirt ja nur eine kleine Summe fÜr zwÖlf gekochte Eier, und die will er ihm auch gern zahlen.« Das leuchtete den Richtern ein; sie sprachen ein anderes Urteil, und der hollÄndische Kaufmann bezahlte dem Wirt das Dutzend Eier mit Zinsen. Als er aber dem MÄnnlein danken wollte, war es verschwunden. Karl Simrock. Eine Geschichte von dem Berggeist RÜbezahl. Es lebte ein Bauer in Schlesien, der war steinreich. Man brauchte eine volle Stunde, um nur einmal Über seine Felder zu gehen. Im Sommer stand Überall das Korn so hoch, daß es ihn um eine KopfeslÄnge Überragte, und er selbst war wirklich nicht klein. Aber so reich der Bauer war, so hartherzig und habgierig war er auch. Seine Knechte mußten doppelt soviel arbeiten wie die bei den anderen Bauern und erhielten doch nur halb soviel Lohn. Daher war er in der ganzen Umgegend als der Ärgste Geizhals bekannt, und schließlich hÖrte auch RÜbezahl, der Berggeist, davon. Dieser beschloß deshalb, den Bauer zu zÜchtigen. Das machte er aber so. Er nahm die Gestalt eines Knechts an, aber eines sehr schwÄchlichen, und als solcher ging er zu dem Bauer und sprach: »Ach, Herr, nehmt mich doch als Drescher in Euren Dienst! Ich arbeite fÜr zwei und verlange nur wenig Lohn.« »Erst muß ich sehen, ob du auch stark genug bist«, sagte der Bauer und ging mit ihm in die Scheune, wo er dem Knecht Arbeit gab. Wie wunderte sich aber der Herr, als er sah, mit welcher Kraft und Gewandtheit der Knecht den Dreschflegel handhabte! Vom frÜhen Morgen bis zum spÄten Abend drosch er tapfer drauf los, ohne zu ermÜden Als nun des Dreschers Zeit um war, bat er sich zum Lohn nur so viel Korn aus, wie er forttragen kÖnne. Damit war sein Herr wohl zufrieden, weil er bei sich dachte, das wÜrde ja nicht viel sein. Wie erstaunte er aber, als der kleine Kerl einen der grÖßten SÄcke nahm, ihn bis oben an den Rand fÜllte, und dann noch einen und zuletzt einen dritten und schließlich alle drei auf den RÜcken schwang und damit forteilen wollte! »Holla!« rief der Bauer und versuchte ihm die SÄcke herunterzureißen. Doch ehe er sich’s versah, drehte sich der dÜrre Drescher um, packte die ganze Scheune auf den RÜcken und fuhr damit in die LÜfte, auf Nimmerwiedersehen! Da erkannte der Bauer, daß es kein anderer gewesen war als der Berggeist RÜbezahl, der ihn betrogen hatte. Er nahm sich aber die ZÜchtigung so zu Herzen, daß er sich fortan wohl hÜtete, seine Knechte je wieder zu schinden. Ferdinand Goebel. Vor der SeebachmÜhle hielt ein junger Stadtherr mit der Angelrute in der Hand und sprach einen alten Mann an, der vor der TÜr saß: »Ihr seid der MÜller, nicht wahr? »Im Obersee.« »Das kostet nichts.« »SchÖn Dank.« Der junge Fischer ging mit geschwinden Schritten dem Bach entgegen, welcher dem hÖher gelegenen See entfloß, und der Alte sah ihm mit listigem Augenblinzeln nach. Dann rÜckte er den hÖlzernen Stuhl aus dem Schatten und ließ sich die wÄrmende Morgensonne auf den kahlen Kopf scheinen. So saß er wohl eine Stunde lang, da kam der Angler wieder zurÜck; er sah sehr verdrossen aus. »Nun?« fragte der MÜller. »Nichts habe ich gefangen«, erwiderte unwirsch der Stadtherr. »NatÜrlich«, kicherte der Alte. »Fische fangen, wo keine sind, das kann nicht einmal der heilige Petrus. Und im Obersee gibt’s keine Fische.« »Das hÄttet Ihr mir gleich sagen sollen.« »Warum seid Ihr so eilig davongerannt? Aber jetzt kommt mit mir an den Untersee! Dort werdet Ihr reichlich entschÄdigt werden. Und zu Mittag soll Euch meine Enkelin die Fische blausieden, und ein guter Trunk ist in der SeebachmÜhle auch zu haben.« Gegen Mittag kam der Alte mit dem Fremden zurÜck, und letzterer sah sehr vergnÜgt drein. »Gebt mir die Fische«, sprach der MÜller, »und setzt Euch auf die Bank, bis die Mahlzeit angerichtet ist!« Er trug den reichen Fang ins Haus und nahm dann Platz neben seinem Gast. Der junge Stadtherr streckte behaglich seine bestiefelten Beine aus und reckte die Arme. »Wie kommt’s denn, Alter,« fragte er, »daß es im Obersee keine Fische gibt?« »Das will ich Euch berichten«, entgegnete der MÜller. »Kein Mensch auf Erden weiß das besser als ich. Aber Ihr mÜßt mir versprechen, reinen Mund zu halten.« Seine grauen Augen funkelten seltsam, und mit gedÄmpfter Stimme begann er zu erzÄhlen: »Heutzutage lÄßt er sich nicht mehr blicken, aber noch vor dreißig Jahren konnte man ihn in mondhellen NÄchten am Obersee sitzen sehen, und er war nicht so arg, als man ihn verschrien hatte.« »Von wem sprecht Ihr?« fragte der Fremde. »Ei, von meinem Duzbruder, dem Wassermann. Ich fing ihn im Netz und hielt ihn fÜr einen Hecht. Aber als ich ihn ans Ufer gebracht hatte, verwandelte er sich in einen Mann mit langen ZÄhnen und grÜnen Haaren und bat mich winselnd um Erbarmen. Was war da zu machen? Ich lÖste ihn aus den Maschen, und dann wurden wir Freunde und tranken BrÜderschaft miteinander.« »Ihr habt mit dem Wassermann BrÜderschaft getrunken?« »So ist es, und ich habe nie einen lustigeren Kameraden gehabt. Eines Tages lud er mich zu Tisch. Zuvor gab er mir ein ÖlflÄschchen, und mit dem Öl mußte ich meinen Leib salben. Dann fuhren wir hinunter in den See, wohl fÜnfzig Klafter tief. Unten aber geleitete mich mein Kamerad in sein Haus, und dann ging’s zur Mahlzeit. SchÖne Nixen mit schillernden Augen trugen die dampfenden SchÜsseln auf und schnalzten mit den schuppigen SchwÄnzen, daß es eine Lust war. Und Fische aller Art spielten uns zu HÄupten wie hier oben die Schwalben und die Schmetterlinge. Als wir uns gesÄttigt hatten, fÜhrte mich der Wassermann in einen Saal. Da standen irdene TÖpfe, hundert und mehr, und in jedem Topf war ein Ticken vernehmbar wie von einer Wanduhr. ‚Das sind die Seelen der Menschen, die im See ertrunken sind‘, erklÄrte mein Wirt, und mir fuhr ein Schauer Über den ganzen Leib. Es war aber auf jedem Topf der Name des Ertrunkenen geschrieben, und mehr als einer war mir bekannt. Eine Woche spÄter war Kirchtag in Seedorf, und da ich wußte, daß der Wassermann nie einen Kirchweihtanz versÄumte, so schloß ich daraus, daß er an diesem Tage nicht zu Hause sein werde. Also salbte ich meinen Leib mit dem zauberkrÄftigen Öl und tauchte in den See, denn als Am nÄchsten Abend, als der Mond ins Wasser schien, legte ich mich auf die Lauer. Da sah ich ihn, den Wassermann meine ich, wie er mit einer Weidenrute ingrimmig in den See schlug; dazu schrie er: ‚Forelle, Hecht und Aal, Packt euch allzumal! Fort, ihr Seelenfresser, Fort aus meinem GewÄsser!‘ Ich schlich mich nÄher heran und sah, wie die Fische, die blinkenden RÜcken aneinandergedrÄngt, den Bach hinunterflohen bis in den Untersee. Und seit jenem Tag ist der Obersee leer von Fischen. Der Wassermann duldet in seinem Gebiet keinen einzigen mehr, weil er meint, sie hÄtten ihm die Seelen aufgefressen. Über den Untersee aber hat er keine Gewalt; das macht der Bildstock am Ufer.« »Und ist der Wassermann nicht hinter Eure Schliche gekommen?« fragte der Fremde. »Das fÜrchte ich eben«, versetzte der Alte. »Und ich hÜte mich wohl, dem Obersee nahe zu kommen. Aber es Die befreiten Seelen. »Was war das fÜr eine Seele?« Der Alte stockte. Endlich sprach er scheu: »Es war die Seele einer bitterbÖsen Frau, und weil sie mir das Leben zur HÖlle gemacht, bevor sie im See ertrank, so wollte ich sie noch eine Weile in dem Topf zappeln lassen.« Der Stadtherr schauderte. Der alte MÜller aber erhob sich von seinem Sitz, legte den Finger auf den Mund und ging ins Haus. Jetzt erschien auf der TÜrschwelle ein hÜbsches blondgezÖpftes MÄdchen mit weißer SchÜrze und meldete, die Fische seien angerichtet. »Gelt,« setzte sie hinzu, »der Großvater hat Euch allerhand nÄrrisches Zeug erzÄhlt? Der Arme ist vor zwei Jahren in das MÜhlenwehr geraten und mit knapper Not herausgezogen worden. Seit der Zeit ist es hier« — sie tippte mit dem Finger auf die Stirn — »nicht ganz richtig mit ihm, aber er tut niemandem etwas zuleide.« Darauf fÜhrte sie den hungrigen Gast in das Haus, und dieser labte sich an den blaugesottenen Forellen und an dem kÜhlen Landwein, den ihm die SchÖne einschenkte. Der alte MÜller kam nicht mehr zum Vorschein. Als der Fremde im nÄchsten Sommer wieder in der SeebachmÜhle vorsprach, trug das blonde MÄdchen ein »In der letzten Zeit«, sprach sie mit nassen Augen, »war er ganz verwirrt und redete immer von seiner Schwiegermutter, die er erlÖsen mÜsse. — — — Gott sei seiner armen Seele gnÄdig!« Rudolf Baumbach. Im Prater, dem großen Öffentlichen Park der alten Kaiserstadt Wien, wurde an einem herrlichen Sommertage ein Volksfest gefeiert, zu dem sich Tausende von geputzten und frÖhlichen Menschen eingefunden hatten. Hier und da sah man aber auch schlecht gekleidete Bettler, OrgelmÄnner, Harfenspieler, Geiger und andere verschÄmte Arme, die auf milde Gaben von ihren glÜcklicheren Mitmenschen hofften und in der Tat manchen Kreuzer davontrugen. Nur einem war es noch nicht gelungen, die Aufmerksamkeit der VorÜbergehenden auf sich zu lenken, obgleich er sich die grÖßte MÜhe zu geben schien: das war ein alter graukÖpfiger Geiger. Schon lange stand er im Schatten eines hohen, breiten Baumes und fiedelte tÜchtig drauf los. Die rechte Hand, die den Bogen fÜhrte, hatte nur drei Finger. Sein Gesicht war durch eine tiefe Narbe entstellt. Das eine Bein war vom Knie herab von Holz. Um seine Schultern hing ein Freilich genoß der Alte eine kleine Pension; da diese aber nicht zu seinem Lebensunterhalt genÜgte, so hatte er sich auf die Musik verlegt, die er sozusagen von seinem Vater ererbt hatte, denn der war ein BÖhme gewesen, und die BÖhmen sind ja alle von Natur musikalisch. Vor unserm Geiger, der sich manchmal zur StÜtze an den Baumstamm lehnte, saß aufrecht und mit des Invaliden Hut im Maule sein treuer Pudel, um etwaige hingeworfene GeldstÜcke einzusammeln. Bis zur spÄten Nachmittagstunde jedoch war der Hut noch ganz leer, und wenn es so weiterging, mußten Herr und Hund sich ohne Abendbrot schlafen legen. Da trat aus der vorbeiwogenden Menge ein fein gekleideter Herr hervor, der den Alten schon eine Zeitlang beobachtet hatte, drÜckte ihm ein GoldstÜck in die Hand und sprach freundlich, aber in gebrochenem Deutsch: »Leiht mir doch Eure Geige auf ein StÜndchen! Ihr seid schon mÜde, und ich bin noch frisch.« Mit einem Blick des Dankes reichte der Geiger sein Instrument dem Fremden, denn was dieser wollte, konnte er sich wohl denken. Auch war die Geige keine von den schlech »Jetzt, Kollege,« sprach er endlich, »will ich den Leuten eins aufspielen, und Ihr mÖgt das Geld annehmen.« Damit fing er an zu spielen, daß der Alte neugierig die Geige betrachtete und meinte, es sei seine eigene gar nicht mehr, so hell und voll, so freudig und dann wieder so traurig und klagend quollen die TÖne aus ihr hervor. Nun blieben auch die VorÜbergehenden stehen und wunderten sich des seltsamen Schauspiels. Selbst die Kutschen der Vornehmen hielten an, und bald regnete es nicht nur Kupfer, sondern auch Silber und Gold in den Hut, so daß der Pudel ihn nicht mehr halten konnte und vor Ärger oder VergnÜgen zu knurren begann. »Macht den Hut leer!« riefen die Leute dem Invaliden zu. »Er wird leicht noch einmal voll.« Das tat der Alte denn auch, und richtig! bald mußte er ihn zum zweiten Male in den Sack leeren, in welchem er seine Violine zu tragen pflegte. Der Fremde aber stand da mit leuchtenden Augen vor der ungeheuren Menschenmasse und entzÜckte mit seinem Spiel aller Herzen. Ein Bravo folgte dem andern, und keiner wich vom Platze. Als nun aber des Invaliden Kollege schließlich in die Melodie der Österreichischen Nationalhymne »Gott erhalte Franz, den Kaiser!« Überging, da flogen HÜte und MÜtzen »Wer war das?« rief das Volk. Da trat ein Herr vor und sagte: »Ich kenne ihn wohl, es war der berÜhmte Alexander Boucher, der hier seine Kunst im Dienste der Barmherzigkeit Übte. Laßt uns aber auch seinem edlen Beispiel folgen!« Damit nahm er seinen eigenen Hut, ging herum und sammelte noch einmal, und aufs neue flogen die GeldstÜcke hinein. Dann rief er laut: »Boucher lebe hoch!« »Hoch! hoch! hoch!« rief das Volk, und der alte Musikant, dem die TrÄnen in den Augen standen, faltete die HÄnde und sprach ein inbrÜnstiges Gebet fÜr seinen Kollegen. W. O. von Horn. Ein großer Herr hatte sich einmal im Walde verirrt und kam gegen Abend an die HÜtte eines armen KÖhlers. Der war selbst Über Land, und die Frau kannte den gnÄdigen Herrn nicht, doch beherbergte sie ihn, so gut sie konnte, setzte ihm von ihren besten ErdÄpfeln vor und sagte, er mÜsse leider auf dem Heuboden schlafen, denn es sei nur ein einziges Bett im Hause. Da nun aber der große Herr auch großen Hunger mitgebracht hatte und todmÜde war, so schmeckten ihm die ErdÄpfel so gut wie die frischesten Eidotter, und auf dem duftenden Heu schlief er besser als auf den weichsten Daunen. Das rÜhmte er denn auch gegen die Frau, als er sich am nÄchsten Morgen wieder auf den Weg machen wollte, und schenkte ihr dabei ein GoldstÜck, welches sie zum Andenken behalten solle. Sobald der KÖhler heimkehrte, erzÄhlte ihm seine Frau von dem vornehmen Gast und zeigte ihm das Geschenk. Aus der Beschreibung, die sie ihm von dem hohen Herrn machte, schloß der KÖhler ganz richtig, daß es der FÜrst des Landes gewesen war, und sagte: »Es freut mich ungemein, daß ihm die ErdÄpfel wie Eidotter geschmeckt haben, doch ein Wunder ist es nicht, denn bessere wachsen nirgends auf der Welt als hier in unserm sandigen Waldboden. Allein ein GoldstÜck fÜr ein bescheidenes Abendbrot und eine Nacht auf dem Heuboden, das ist allzuviel! Ich will mich nÄchster Tage aufmachen und dem FÜrsten einen ordentlichen Korbvoll ErdÄpfel bringen; er wird sie wohl nicht ausschlagen.« Es dauerte keine acht Tage, so stand auch der KÖhler in seinem Sonntagsrock und mit dem Korb in der Hand vor dem fÜrstlichen Schloß und begehrte Einlaß. Anfangs wollten ihn die Schildwachen und Lakaien nicht durchlassen; er kehrte sich aber wenig daran und sagte, sie sollten dem So kam er denn auch wirklich in den Audienzsaal und sprach: »GnÄdiger Herr, Ihr habt neulich bei mir zu Hause geherbergt und eine SchÜssel ErdÄpfel nebst einem Nachtlager auf dem Heu mit einem Dukaten bezahlt. Das war zuviel, obschon Ihr ein großer Herr seid. Darum bringe ich Euch noch ein KÖrbchen von den ErdÄpfeln, die Euch wie frische Eidotter geschmeckt haben. MÖgen sie Euch wohl bekommen, und wenn Ihr wieder einmal bei uns einkehrt, so stehen Euch noch mehr zu Diensten.« Die Einfalt und Herzlichkeit des guten Mannes gefielen dem FÜrsten gar sehr, und weil er auch gerade bei guter Laune war, schenkte er ihm einen Hof mit dreißig Acker Land. Nun hatte aber der KÖhler einen reichen Bruder, der neidisch und habsÜchtig war. Als dieser von dem GlÜck des KÖhlers hÖrte, dachte er: »Das kÖnnte mir auch blÜhen. Ich hab’ ein Pferd, das dem FÜrsten gefÄllt; doch meinte er neulich, als ich sechzig Dukaten dafÜr forderte, es sei ihm zu teuer. Jetzt geh’ ich hin und schenk’ es ihm, denn hat er dem Bruder einen Hof mit dreißig Acker Land fÜr ein KÖrbchen ErdÄpfel geschenkt, so wird mir gewiß noch ein viel grÖßeres Gegengeschenk zuteil.« Da nahm er das Pferd aus dem Stall und fÜhrte es »FÜrstliche Gnaden,« sagte er, »ich weiß, daß Euch mein Pferd neulich in die Augen gestochen hat. FÜr Geld hab’ ich es damals nicht lassen wollen, aber seid jetzt so gnÄdig und nehmt es zum Geschenk von mir an! Es steht schon draußen vor dem Schloß und ist ein so stattliches Tier, wie Ihr kaum eins in Eurem Marstall habt.« Der FÜrst merkte sogleich, wo der Hase hÜpfte, und dachte bei sich: »Warte nur, du Gaudieb, dich will ich bezahlen!« »Ich nehme Euer Pferd von Herzen gern an, lieber Mann,« sprach er, »obgleich ich kaum weiß, was ich Euch dafÜr zum Gegengeschenk geben soll. Karl Simrock. Auf einer kleinen AnhÖhe liegt der Hermeshof und schaut weit ins stille Tal nach Zell hinab bis zur Wallfahrtskirche. In diese war der alte Bauer, solange er noch gesund war, manchen Samstag gewandelt »der Mutter Gottes zuliebe«, und als er krank und krÄnker ward, hatte er manchmal seine Kinder in die Kapelle hinabgesandt, damit sie um eine glÜckliche Sterbestunde beteten. Der Kaplan von Zell aber brachte ihm Öfters die heilige Wegzehrung. Darum fÜrchtete der Hermesbauer das Sterben auch nicht. Es war ein heißer Sommertag, als der Sensenmann auf dem Hermeshof anklopfte, um den Bauer zu seiner Frau, die schon seit Jahren auf dem Kirchhofe von Zell ruhte, abzuholen. Die Kinder, alle erwachsen, umstanden das Sterbelager des Vaters. Drunten im Tal arbeiteten Knechte und MÄgde, um die Weizenernte heimzubringen. DrÜben von der Kinzig her zog ein Gewitter dem Tale zu. Schon rollte der Donner in der Ferne. »Ich kann allein sterben«, hub der Alte zu seinen Kindern zu reden an. »Helft ihr drunten den Leuten Garben binden und sorgt fÜr euer Brot zur Winterszeit! Ich brauch’ keins mehr, ich wart’ auf den Winter drunten im Gottesacker.« Hinter dem uralten Kasten in der Sterbekammer stand eine alte, lange Flinte, im Hause von jeher nur »der Brummler« genannt. Schon der Urahn des Sterbenden hatte mit dem Brummler das Neujahr und die Kirchweih ins Tal hinuntergeschossen. Mit ihm wollte auch der sterbende Hermesbauer seinen Tod ansagen. Nun gab er jedem seiner Kinder die Hand zum Abschied und mahnte sie zur Eile mit den Worten: »Aber jetzt geht schnell, ’s donnert schon wieder.« Der Alte hatte allezeit seinen Willen, fest wie Eisen. Sein letzter Wille aber war heute wie Diamant. Die Eben war die letzte Garbe gebunden und geladen, da fuhren Blitz und Schlag Übers Tal hin. Eine plÖtzliche Stille folgte dem Zucken und Rollen vom Himmel her — da fÄllt ein Schuß vom Hof herab: der Brummler gibt das Todessignal des Vaters. Neben dem Erntewagen knieen die Kinder und beten ein Vaterunser und »Herr, gib ihm die ewige Ruhe, und das ewige Licht leuchte ihm!«. Dann fahren sie ihre Garben den Berg hinauf ins Vaterhaus. Der Vater ist tot, da sie seine Stube betreten. Die Ernte ist daheim, und der Vater auch. Heinrich Hansjakob. Es war einmal ein frommer Einsiedel, den die Leute Bruder Klaus hießen. Im Schatten alter Eichen auf einer Waldwiese stand seine Zelle, und drei Kameraden teilten mit ihm den engen Raum, ein Fuchs, ein Waldkater und ein Hase. Er hatte die Tiere von ihrer frÜhsten Jugend an aufgezogen, und da war es ihm nicht schwer geworden, sie Bruder Klaus lebte gerade nicht schlecht. Die umwohnenden Bauern versorgten ihn reichlich mit Speise und Trank, und daher litten auch die drei Tiere keinen Mangel. Aber es kamen schlimme Zeiten. Mißwachs und Hagelschlag hatten die Erntehoffnung zunichte gemacht, und die Liebesgaben der Landleute flossen spÄrlich. Am Ende, als der bleiche Hunger durch die Dorfgassen schlich, blieben die Spenden ganz aus, und der arme Einsiedel sah sich auf die FrÜchte des Waldes angewiesen. Aber die HolzÄpfel und die Schlehen wollten ihm gar nicht behagen, und er magerte sichtlich ab. Die Not ihres Herrn ging den drei Tieren sehr zu Herzen, zumal da sie selber unter dem Mangel schwer zu leiden hatten. Am besten noch befand sich der Hase, denn in der Umgebung der Einsiedelei wuchs Gras und Klee in Menge, aber Kater und Fuchs vermißten schmerzlich die fetten Bissen, die ihnen Bruder Klaus vordem gereicht hatte, und sie begannen, den Hasen mit scheelen Augen anzusehen. Eines Tages, als der letztere im Bergklee seine Mahlzeit hielt, traten Fuchs und Kater vor den Einsiedel, und der Fuchs hub also an zu sprechen: »Lieber Vater! So kann es nicht lÄnger fortgehen. Allzulange schon entbehrst du krÄftiger Nahrung, und die Kutte schlottert bedenklich um deinen abgezehrten Leib. Wie wÄre So sprach der Fuchs. Aber Bruder Klaus runzelte die Stirn und sprach zÜrnend: »Mitnichten, du Arger! Der Hase hat, wie ihr beide auch, Salz und Brot mit mir gegessen. Ferne sei es von mir, das heilige Gastrecht in schnÖder Weise zu verletzen! Hebet euch weg!« Jetzt ergriff der Waldkater das Wort und sprach schmeichelnd: »Deine Rede, mein Vater, klingt lieblich wie Harfensaiten und Schalmeien. Wie aber, wenn der Hase selbst sich erbÖte, den Opfertod fÜr dich zu leiden?« »Dann freilich — — —« sprach Bruder Klaus und zog die Schultern in die HÖhe. »Aber das wird der Hase wohl bleibenlassen.« Mit diesen Worten entließ er die Tiere. Am andern Morgen, als der Einsiedel eine Wassersuppe genossen und sein GlÖcklein gelÄutet hatte und ausruhend auf der Steinbank vor der TÜr saß, kamen Fuchs, Kater und Hase heran, stellten sich vor der Bank auf und verneigten sich. Dann nahm der Fuchs das Wort: »Bruder Klaus, du bist uns allezeit ein gÜtiger Herr gewesen und hast jeden Bissen mit uns geteilt. Darum halten wir es fÜr unsere Pflicht, dir jetzt, da du Not leidest, nach KrÄften beizustehen und dein teures Leben zu fristen. Bruder Klaus und die treuen Tiere. Da sprach der Waldkater: »Freund, du sprichst wie ein Tor. Weißt du nicht, daß Fuchsfleisch eine hÖchst ungesunde Speise ist? Willst du unsern WohltÄter vor der Zeit unter den Rasen bringen?« Der Fuchs seufzte tief auf. Bruder Klaus aber sprach gerÜhrt: »Lebe, du treues Tier, und freue dich deines Lebens!« Darnach erhob der Kater seine Stimme: »So?« sprach der Fuchs. »Glaubst du etwas Besseres zu sein als ich — du, ein fleischfressendes Krallentier? Nein, Herr, das Fleisch dieses Maushundes, dem die Knochen allenthalben hervorstehen wie die Dornen am Schlehbusch, darfst du nimmermehr genießen!« »Geh hin, mein Freund!« sprach Bruder Klaus zu dem Kater. »Der Wille, nicht die Gabe macht den Geber. Ich danke dir. Dein Opfer nehme ich nicht an.« »Wenn ich auch zuletzt komme, so ist doch mein Eifer dir zu dienen nicht geringer als der meiner Kameraden. Nimm mich hin, ehrwÜrdiger Vater! Ich sterbe gern fÜr dich.« Da fuhr Bruder Klaus mit dem Ärmel seines hÄrenen Gewandes Über die feuchten Augen, beugte sich zu dem Hasen nieder und ergriff ihn bei den Ohren. »Dir werde dein Wille, du treues Tier!« sprach er und trug den Hasen in die Klause. Nach einiger Zeit kam er zurÜck und hÄngte den blutigen Hasenbalg auf einen Pfahl seines Zaunes zum Trocknen auf. In seinen Augen aber leuchteten TrÄnen der RÜhrung. Am Abend gab es in der Klause Hasenpfeffer und am nÄchsten Mittag Hasenbraten mit Kraut, und unter dem Tisch saßen Fuchs und Kater und labten sich an den KnÖchelchen, welche der Einsiedel den treuen Tieren zuwarf. Rudolf Baumbach. In der Amtsstube des Amtmanns stand ein Stiefelknecht, der brummte unzufrieden vor sich hin: »Es ist doch ein jÄmmerlich Ding um das Leben, wenn man immer so im Winkel stehen und auf die Herren Stiefel warten muß! Und wie beschmutzt kommen sie oft an, wie grob behandeln sie mich armen Knecht! Wenn ich den einen ausziehe, so tritt mich der andere. Ja, die Stiefel haben’s gut, die Die Stiefel, denen diese Rede galt, gehÖrten dem Schreiber. Er hatte sie ausgezogen und an die Wand gestellt, denn in der Amtsstube trug er lieber ein Paar weiche Schlappschuhe an den FÜßen. Bei der Rede des unzufriedenen Stiefelknechts machten beide Stiefel lange SchÄfte, gerade wie die Menschen bei anzÜglichen Reden anderer Leute lange Gesichter zu machen pflegen. Da stieß der Stiefel des rechten Beines den Stiefel des linken Beines an und sprach: »Hast du’s gehÖrt, Bruder? Der dumme Stiefelknecht nennt uns Herren und meint, wir hÄtten’s gut, weil er nicht weiß, wie gut er selber daran ist. Der Lump hat den leichtesten Dienst von uns allen. Aber wir, wir werden den ganzen Tag durch dick und dÜnn gejagt. Im Sommer ersticken wir fast vor Staub, im Winter frieren wir steif im Schnee, und wenn’s regnet, ersaufen wir fast. Und dann — ach! das Pflaster und all die scharfen Steine, die auch kein Erbarmen kennen! Ich mÖchte nur wissen, wieviel Haut sie mir heute schon wieder abgekratzt haben, denn ich glaube wahrhaftig, ich bin jetzt unten beinah durchsichtig geworden. Es ist ein mÜhseliges Leben, wenn man immer den Diener spielen muß.« Der Stiefelknecht horchte auf. »Bruder,« sprach jetzt der Stiefel vom linken Bein zu dem Stiefel vom rechten Bein, »das ewige Treten wollte ich mir noch gefallen lassen, aber das Rumpeln mit der BÜrste am Abend oder am frÜhen Morgen, das verdrießt mich am meisten. Ich mÖchte bloß wissen, warum wir bei all unserm Elend auch noch glÄnzen sollen. Da hat’s unser Herr, der Schreiber, gut. Dort sitzt er bequem auf seinem Bock und schreibt. Wenn ich doch auch ein Schreiber wÄre!« »Das meine ich auch«, seufzte der Stiefelknecht. Der Schreiber spritzte seine Feder aus, reckte sich ein wenig und seufzte: »Gottlob, daß wieder ein Tag vorbei ist! So ein Schreiber hat doch das jÄmmerlichste Leben. Was ist er anders als ein armseliger Federknecht? Da lob’ ich mir’s, wenn man sein eigener Herr ist, wie der Amtmann. Der arbeitet nur, wenn er Lust hat, und wird alle Tage dicker. Ich habe die Plackerei satt. Ja, wÄre ich doch auch Amtmann!« Er zog seufzend die Stiefel an und steckte die Schlappschuhe in die Tasche seines fadenscheinigen Rockes. Da trat der Herr Amtmann ein und sagte brummig: »Du kannst nach Hause gehen, es ist Feierabend. Du weißt gar nicht, wie gut du’s hast.« Der Amtmann ging in seine Wohnstube zurÜck. Weil er aber die TÜr offen stehen ließ, konnte der Stiefelknecht alles hÖren, was darin vorging, und bald hÖrte er auch den Amtmann im tiefsten Baß brummen: »Da lÄuft er hin, der lockere Schreiber. Das Volk hat’s gut! Nun setzt er sich zu einem Glase Bier und schmaucht in aller Ruhe seine Pfeife. Und ich? Bis morgen soll die Arbeit fertig sein. Da liegt sie, noch kaum angefangen. Was nur der Herr Minister denkt! Immer mehr Arbeit und keinen Heller Zulage! Der Geier hole solchen Dienst! Ach, wenn ich doch mein eigener Herr wÄre! Ja, ja, der Minister hat gut befehlen.« »Sonderbar!« dachte der Stiefelknecht. »Der Dicke klagt auch.« Da pochte es an der TÜr. »Herein!« rief der Amtmann. Es war sein Hausarzt. »Gut, daß Sie kommen, Herr Doktor«, sagte der Amtmann. »Ich befinde mich gar nicht wohl und muß noch die Nacht hindurch arbeiten. O der Dienst, der Dienst!« Der Doktor befÜhlte des Amtmanns Puls und besah ihm die Zunge; dann sagte er: »Legen Sie sich schlafen, bester Freund! Ihnen fehlt weiter nichts als Ruhe.« »Jawohl, schlafen!« brummte der Amtmann. »Doktorchen, Sie haben’s gut. Sie sind Ihr eigener Herr.« Der Doktor hielt sich den Bauch vor Lachen und rief: »Ich mein eigener Herr? Aller Welt Diener bin ich. Tag Der Doktor ging, und der Stiefelknecht dachte: »Wieder ein Knecht mehr. Ich bekomme viel Gesellschaft.« Da klopfte es wieder, und der Herr Minister trat herein und entschuldigte sich hÖflich, daß er noch so spÄt komme. »Mein lieber Herr Amtmann,« sprach der Minister, »schaffen Sie mir gefÄlligst bis morgen frÜh die SchriftstÜcke, welche auf diesem Bogen hier verzeichnet stehen; ich brauche sie notwendig. Ich komme eben vom FÜrsten; er ist in der Übelsten Laune, und ich habe einen schweren Stand mit ihm gehabt. Am liebsten hÄtte ich sogleich mein Abschiedsgesuch eingereicht, dann wÄre ich mein eigener Herr.« Bei diesen Worten horchte der Stiefelknecht hoch auf. »Aber es geht nicht«, fuhr der Minister fort. »Ich darf den FÜrsten, meinen allergnÄdigsten Herrn, nicht im Stich lassen.« »Was ist denn geschehen?« fragte der Amtmann erschrocken. »Ach!« seufzte der Minister, »wir sollen Geld schaffen, viel Geld, und alle Kassen sind doch leer. Glauben Sie mir, kein Mensch hat’s so sauer wie ein Minister!« »Aber wozu brauchen wir denn Geld?« fragte der Amtmann. »Sollen wir etwa Zulage erhalten?« »Zulage?!« rief der Minister. »Nein, sicher nicht! Eher kÖnnte es AbzÜge geben! Der Krieg ist vor den Toren, das Heer wird auf den Kriegsfuß gesetzt, und dazu braucht der FÜrst Geld, Geld und wiederum Geld! Der arme Herr hat keine ruhige Stunde mehr, die Sorgen lassen ihn nicht schlafen. Kurz, es ist eine bÖse Zeit.« Der Minister seufzte, der Amtmann seufzte auch; der Stiefelknecht aber seufzte nicht. Er hatte alles mit angehÖrt und lachte nun in sich hinein: »Knechte, lauter Knechte! Nicht einmal der LandesfÜrst ist sein eigener Herr!« Und von dieser Stunde an war der Stiefelknecht mit seinem bescheidenen Lose zufrieden und diente den Herren Stiefeln als geduldiger Knecht. Julius Sturm. Bei den Bauern oben in den Bergen wurden wir Schneider fÜr die langen Winterabende zumeist mit Spanlicht bedient. Das war ein ehrliches, gesundes Licht und uns lieber als Kerzenlicht. Wenn wir den ganzen, langen Abend bei solchen UnschlittschwÄnzlein nadeln sollten, von denen volle zwÖlf auf ein Pfund gingen, da sagte mein guter Meister manchmal: »Hausfrau, das ewige LÄmplein in der Kirche ist mir lieber als dein Licht da.« Beim Kaufmann jedoch brannten wir grÖßere Kerzen, von denen acht oder sogar nur sechs auf ein Pfund gingen. Die gaben freilich einen helleren Schein, das heißt, wenn sie ordentlich geschneuzt wurden; trotzdem besorgten wir alle feineren Arbeiten beim lieben Tagesschein und verschoben die grÖberen Sachen auf das Kerzenlicht. Einmal nun im Advent arbeiteten wir beim Kaufmann. Dieser kehrte spÄtabends von Graz heim. Als er uns um das matte Kerzenlicht kauern und lugen sah, klopfte er den Schnee von den Schuhen, blinzelte uns an und sagte: »Na, Schneider, heut’ hab’ ich was heimgebracht fÜr euch!« Und als die Waren ausgepackt wurden, da kam eine stattliche Öllampe zum Vorschein und ein langes Rohr aus Glas dazu und ein grÜner Papierschirm und ein Zwilchstreifen und ein kleines, feuchtes FÄßlein. »Was du alles fÜr Sachen hast!« sagte mein Meister. »Das alles miteinander«, berichtete der Kaufmann, »gehÖrt zu dem neuen Licht, das aus Amerika gekommen Er fÜllte die Lampe aus dem FÄßlein und zog den Zwilchstreifen durch das glÄnzende Ding mit der eichelfÖrmigen, geschlitzten Kapsel. Dann setzte er die Bestandteile zusammen, zÜndete das hervorstehende Ende des Dochtes an, stÜlpte das bauchige Glasrohr darÜber, daß wir meinten, so nahe an der Flamme mÜsse es gewiß zerspringen — und »Nun«, sagte er, »sollt ihr einmal sehen!« Und wir sahen es. Es war ein gar trÜbes Licht, das mit seinem schwarzen, stinkenden Rauch sogleich das Glasrohr schwÄrzte. Der Kaufmann drehte an dem feinen SchrÄublein den Docht weiter hinauf, da rauchte es noch mehr. Er drehte ihn tiefer nieder, da wurde es finster, und als wir zu lachen begannen, knurrte er: »Na, mir scheint, dieser LampenhÄndler hat mich sauber angeschmiert! Aber ich hab’s doch selber gesehen in der Stadt, wie das Zeug wunderschÖn brennt!« »Versuchen wir’s einmal«, sagte mein Meister, »und tun das GlasrÖhrlein ganz weg!« Aber sogleich riß er seine Finger mit einem hellen Aufschrei davon. Als dann das Glas mittels eines Lappens entfernt war, brannte die Flamme noch viel trÜber, und das Kerzenlicht daneben zuckte nicht ohne Schadenfreude hin und her. Nachdem wir mit der Lampe noch allerlei versucht hatten und die Stube endlich voll Rauch geworden war, schalt der »Was ist denn das fÜr ein Öl, das Petroleum?« fragte der Geselle. »Es soll aus der Erde herausrinnen«, erklÄrte der Kaufmann. »Ja so!« rief der Geselle. »Dann wird’s freilich nichts taugen, dann ist’s das helle Wasser.« »Sei mir still, ich mag nichts mehr davon hÖren!« sagte der Kaufmann und stellte die Lampe in den Winkel. Nun vergingen zwei Tage. Da kam der Thomastag, und mein Meister und der Hausherr gingen noch vor Tagesanbruch zur FrÜhmesse. Ich saß allein bei der Kerze und schneiderte. Bald trat die junge Viehmagd herein, die vorhin im Stalle die KÜhe gemolken hatte, und setzte sich an meinen Tisch, um an ihr Christtagskleid ein seidenes Schleiflein zu nÄhen. Da wollten wir doch gar zu gern noch einmal die neue Lampe anzÜnden, da niemand mehr im Hause war, der es uns verwehrt hÄtte. So holten wir denn die neue Lampe aus dem Winkel hervor, stellten sie sorgfÄltig mitten auf den Tisch und zÜndeten sie an. Es war aber dasselbe trÜbe, rußende Licht wie das erstemal. Ich drehte den Docht hÖher und tiefer So sind wir ganz zufÄlligerweise dem Geheimnis der Wunderlampe auf die Spur gekommen, daß man nÄmlich den Docht nicht in die freie Luft hineinstehen lassen, sondern ganz in den Spalt versenken muß, wenn er brennen soll. Als die beiden Alten aus der Kirche zurÜckkehrten, rief der Hausherr freudig aus: »Da haben wir’s ja! Wer hat’s denn fertiggebracht?« »Der Peter«, antwortete die kleine Viehmagd, denn ich getraute mir nicht den Mund aufzutun. Einmal noch ist die Kerze neben der neuen Lampe angezÜndet worden, aber ach, wie armselig war ihr Licht! »SchÄm’ dich!« rief der Meister und blies sie undankbar aus. Ich wÜßte aber keine andere Neuerung, die beim Landvolk so rasch Eingang gefunden hat, wie vor vierzig Jahren die Petroleumlampe. Peter Rosegger. Der alte Schuhmacher Johann Matthias Palmberger war gestorben, und auf seinem Schemel war ihm sein Sohn Andreas gefolgt. Schon etliche Tage hatte der junge Mann, oft in tiefe Gedanken verloren, dagesessen, als endlich eines Morgens die Mutter zu ihm herantrat und sprach: »Andres, dir fehlt was, und ich weiß auch gar wohl, wo dich der Schuh drÜckt, ohne daß du es mir zu sagen brauchst. Dir gefÄllt es nicht mehr in deines Vaters Hause, und der Hoffartsteufel macht es dir zu enge. Du mÖchtest ein großer Herr Schuhmacher werden, wie du sie auf deiner Wanderschaft in NÜrnberg und Frankfurt gesehen hast, und weißt doch nicht, daß du hier wÄrmer sitzest als hundert andere Meister, die keinen Knieriemen mehr an den Fuß bringen, sondern nur zuschneiden. Aber in Gottes Namen! Willst du fort, so geh, denn halte ich dich zurÜck, so bleibst du ewig unzufrieden; versuchst du’s aber, so wird es dich bald gereuen. Andres, es ist ein großer Unterschied zwischen einer Wanderschaft von etlichen Jahren und einem Abschied von Mutter und Heimat auf immer!« Andreas drehte sich halb auf seinem Schemel herum und sprach: »Mutter, nun ich mir alles recht Überlegt habe, kann ich Euch sagen, daß ich nicht mehr hier bleibe.« »Warum nicht, Andres?« fragte die Witwe und schien »Das will ich Euch kurz sagen, Mutter«, antwortete Andreas. »Es ist hier nichts mit der Schusterei. Was einer in diesem Neste ist, das muß er sein Leben lang bleiben.« »Da hast du recht«, versetzte die Mutter. »Dein seliger Vater hat wohl an die zwanzig Knieriemen zerrissen an sich und an dir, und schließlich hat es doch nur in seinem Lebenslauf geheißen: ‚Der ehrbare Johann Matthias Palmberger, Altschuhmacher und Schutzverwandter dahier.‘ Nichts dahinter und nichts davor.« »Eben darum will ich auch nach England,« fuhr der junge Schuhmacher fort, »oder nach Amerika. Da hat schon mancher sein GlÜck gemacht!« »Jawohl, sein GlÜck gemacht!« stimmte die Witwe dem Sohne bei. »Gerade jetzt erzÄhlt man wieder viel von einem Sattlergesellen aus Schneeberg in Sachsen, — Ackermann heißt er — der ging Über Paris nach London in England und ward daselbst ein so reicher und angesehener Mann, daß jetzt die Grafen und FÜrsten in seinem Hause aus und ein gehen wie bei unsereinem die HÜhner. Seinen armen Freunden in Schneeberg schickt er aber ein GeldstÜck um das andere.« »Ich werde Euer auch nicht vergessen, liebe Mutter!« versicherte der junge Mann auf dem Schemel und stellte die Stiefel des Wirts auf die Seite, nachdem er die letzte Hand darangelegt hatte. »Ich werde Euch schon von Zeit zu Zeit schreiben, wie es mir geht. Und wenn Ihr in einem Briefe von mir leset: ‚Euer dankbarer Sohn, Hofschuhmachermeister Seiner MajestÄt des KÖnigs von Großbritannien, Schottland und Irland‘, — dann dÜrft Ihr Euch flugs aufmachen wie der Erzvater Jakob zu seinem Sohne Joseph in Ägyptenland. Denn ich wollte mich Euer nicht schÄmen, und wenn ich KÖnig wÜrde!« »Bis dahin«, versetzte die Mutter, indem sie sich mit der SchÜrze eine TrÄne aus dem Auge wischte, »darfst du dir um meinetwillen keine Sorge machen, denn ein neues Haus, wie wir es haben, zwei KÜhe im Stall, etliche Morgen Ackerland und eine Wiese an der AltmÜhl sind fÜr ein Witweib mehr als genug.« Sie hatte noch nicht ausgeredet, als Andreas schon anfing, um seinen Schemel herum aufzurÄumen. Die Mutter aber wehrte es ihm und sprach: »Lieber Sohn, das Überlaß mir! Nimm nur das Handwerkszeug, das du als Geselle auf der Wanderschaft brauchst, und schnalle dein BÜndel! Der Ranzen, den du vor drei Jahren aus der Fremde mitgebracht, ist noch ganz gut und hÄngt drÜben in der Kammer. Indes habe ich Zeit, dir zum Abschied dein Leibgericht zu kochen. Denn du sollst erst gegen Abend Und so geschah es denn auch. Andreas schnallte sein WanderbÜndel, aß sein Leibgericht mit gutem Appetit und großem Beifall, plauderte noch ein paar Stunden mit der Mutter Über dies und jenes und ging dann, von ihr bis vor die HaustÜr geleitet, zum Dorf hinaus. Die Witwe aber sprach bei sich, als sie in ihrem StÜblein allein war: »Ich lasse alles liegen und stehen, auch seinen Schemel, denn allzulange wird er nicht wegbleiben.« Und als eine Stunde darauf die Nachbarin ein Paar Schuhe zum Flicken brachte, nahm sie diese ruhig an und sagte: »Morgen abend kÖnnt Ihr wiederkommen und sie abholen, da werden sie fertig sein.« Andreas aber, je weiter er ging, desto lÄnger wurde ihm der Weg nach England und Amerika. Schon auf den Wiesen zwischen den beiden nÄchsten Ortschaften gelobte er, sich mit der Neuen Welt nicht einzulassen. In dem großen, dÜsteren MÖnchswalde gab er auch England auf. In dem tiefen Sande jenseit des Waldes machte er sich schon das nÄher gelegene Frankfurt zum Endziel seiner Wanderschaft. Und als er nun Merkendorf erreichte und ihm da und dort aus den Stuben ein heimliches Abendlicht entgegenschimmerte, wie vom Himmel die ersten Sterne, ja, da fÜhlte er ganz und gar, was es heiße, Mutter und Heimat auf Nimmerwiedersehen zu verlassen. So kam er in die Herberge, nippte ohne großen Appetit an dem Bier, das ihm vorgesetzt wurde, und legte sich dann todmÜde zwischen die WÜrzburger Fuhrleute, die auf dem Stroh in der Stube umherlagen. Sein WanderbÜndel nahm er dabei zum Kopfkissen. Dann lÖschte der Wirt die mit Schmalz gefÜllte Lampe aus, und die Stube blieb nur noch matt vom Licht des Mondes erhellt. Andreas hatte aber einen schlimmen Platz gewÄhlt. Sein Schlafkamerad zur Linken schien nÄmlich von einer SchlÄgerei zu trÄumen. Wenigstens schlug er mit seinen großen und harten FÄusten gewaltig um sich und traf dabei den Schuhmacher so ins Genick, daß dieser erschrocken aufsprang und sich nach einer anderen SchlafstÄtte umschaute. Bald erspÄhte er auch dicht an der Wand zwischen dem Fenster und der StubentÜr so etwas wie eine lange, schmale Tafel oder Bank, auf der weiter nichts stand als ein leerer Scheffel. Nachdem er den vorsichtig herabgenommen und auf den Fußboden gestellt hatte, hob er seinen Ranzen hinauf und streckte sich dann selbst ganz nach seiner Bequemlichkeit auf der vermeintlichen Tafel oder Bank aus; sie war auch gerade lang genug fÜr seine nicht allzu große Gestalt, Wenige Minuten darauf schloß ihm ein sanfter Schlaf die Augen, und eine liebliche Erinnerung aus seiner frÜhsten Jugend zog, in einen Traum verwandelt, durch seine Seele. Es trÄumte ihm, er liege als etwa achtjÄhriger Knabe, zum DarÜber erwachte Andreas und erkannte nun, daß er statt in dem Schlamm der AltmÜhl in einem mit Teig angefÜllten Backtrog lag. Solche langen TrÖge brauchen nÄmlich die Gastwirte dortzulande, wenn sie fÜr Hochzeiten, Kirchweihen und andere Festlichkeiten Brot oder Kuchen backen wollen. Was er trÄumend fÜr ein in dem schwarzen Schlamm liegendes Brett gehalten, war der Trogdeckel gewesen, und als dieser schließlich aus seiner wagerechten Lage wich und umkippte, war der TrÄumer samt seinem WanderbÜndel in den weißen, gÄrenden Brotteig hinabgeglitten. Ehe noch Andreas seine Badewanne mit wachenden Augen grÜndlich beschaut hatte, war er auch schon mit einem Sprunge heraus. Aber was nun anfangen? HÄtte er LÄrm geschlagen, so wÜrde der Zorn des Wirts, dem er das Hoch Seine Mutter hatte indessen auch nur wenig geschlafen, denn ihre Hoffnung auf die baldige Wiederkehr ihres Sohnes war doch allmÄhlich etwas gesunken. So trat sie denn, als der Morgen graute, unter die HaustÜr und sah den Wiesengrund hinab, der fast bis an den MÖnchswald vor ihr lag. Ob sie bei seinem Einzug mehr Freude oder mehr Erstaunen zeigte, war schwer zu unterscheiden. Auch hielt sich Andreas nicht lange bei dieser Frage auf, sondern schlÜpfte aus Furcht, von den Nachbarn gesehen zu werden, so schnell wie mÖglich unter Dach und Fach. Eine Stunde darauf, nachdem er die Teigkruste abgewaschen und sich in sein Hausgewand geworfen hatte, saß Fort in die Fremde begehrte er nicht mehr, sondern suchte sich nach dem Wunsche der Mutter eine LebensgefÄhrtin aus und hielt nach einigen Monaten eine große Hochzeit. Etliche Tage zuvor aber fiel ihm der Hochzeitsteig wieder ein, den er auf seiner Reise nach Amerika verdorben hatte, und er schickte dem Wirt in Merkendorf zur vollen EntschÄdigung drei neue Kronentaler mit der Post, jedoch ohne Namensunterschrift. Karl StÖber. An einem Juliabend im Jahre 1836 saß ein alter SeekapitÄn auf der Veranda seines schÖnen, großen Landhauses, ein halb StÜndlein von der hollÄndischen Stadt Haarlem. Und warum sollte er auch nicht dort sitzen? Er rauchte vom feinsten Kubatabak aus einem echten tÜrkischen Kopf und trank dazu langsam aus einer echten japanischen Tasse den teuersten Mokkakaffee, dachte an seine Sein Diener, ein alter Matrose, den er nach Haarlem geschickt hatte, um EinkÄufe zu machen, war zur Stunde noch nicht wieder aus der Stadt zurÜck. Er mochte wohl so im ersten Halbschlummer liegen und von den Chinesen trÄumen mit ihren Mandelaugen und langen ZÖpfen, da hÖrt er am Fenster etwas bohren, als ob einer da hereinwolle statt durch die HaustÜr. Er steht also behutsam auf und merkt auch sogleich, daß wirklich jemand draußen unterm Fenster ist, der ihm nÄchtlings, und zwar unangemeldet, einen Besuch machen will, vielleicht weniger ihm selbst als seinen goldenen VÖgeln. Da fÄllt’s nun dem Alten siedendheiß auf die Seele, daß leider alle seine SÄbel, Flinten und Pistolen in der Waffensammlung am andern Ende des weitlÄufigen Hauses sind: er hat deshalb kein einziges StÜck, womit er sich wehren kann, und weiß zuerst nicht recht, was er anfangen soll. Mittlerweile ist der Dieb mit seinen Vorbereitungen fertig geworden und hat eine Fensterscheibe aus dem Rahmen entfernt. Da aber ist auch unser alter Seemann seinerseits bereit, ihn zu empfangen. Er hat sich nÄmlich schnell besonnen, daß auf dem Tisch neben seinem Bett eine Flasche Selterwasser steht, fest zugekorkt und oben noch mit dem Draht darum. Schnell hat er den Draht abgenommen und hÄlt nun den Daumen auf den Kork, stellt sich hinter den Fenstervorhang und wartet ab. Eben steckt der Dieb seinen Kopf durch die Scheibe und denkt: »Wo der durchgeht, geht auch der ganze Leib nach!« Nun wußte aber der alte KapitÄn aus seinem Seeleben, daß man einem geschlagenen Feinde keine Ruhe gÖnnen darf. Er stieg deshalb sofort dem Einbrecher nach, der noch betÄubt am Boden lag, und band ihm den Hals mit seinem langen Schnupftuch von echter chinesischer Seide so fest zu, als ob’s ein Halseisen wÄre. Und da der Dieb auch glÜcklicherweise einen derben Strick mitgebracht hatte, Wie man Diebe fÄngt. DafÜr bekam er denn auch vom KÖnig von Holland ein ganz besonderes Dankschreiben, daß er einen so gefÄhrlichen Spitzbuben eigenhÄndig eingefangen und abgeliefert hatte. Merke drum: Das Selterwasser ist ein gut WÄsserlein, und zwar nicht bloß gegen den Durst und allerhand Krankheiten, sondern auch, um Diebe damit zu fangen! Emil Frommel. Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts hausten in der NÄhe eines sÜddeutschen Dorfes zwei große Bauern, der Dohlenhamer und der Ermansperger, jener im Tal, dieser auf der HÖhe. Sie lebten zwar in keiner tÖdlichen Feindschaft miteinander, Gerade auf der Grenze nÄmlich, wo ihre LÄndereien zusammenstießen, erhob sich eine tausendÄstige, dunkle Riesenfichte, die gewiß schon einer der UrgroßvÄter gepflanzt hatte, und die im Laufe der Zeit zum Gegenstand des So vernÜnftig waren die beiden Bauern allerdings gewesen, daß sie nicht gleich Advokaten annahmen und denen zusammen zwanzigmal mehr zahlten, als die ganze Grenzfichte wert war. Allein tief drinnen im Herzen schlug dennoch einem jeden der großbÄuerliche Stolz und Neid. Wenn der Dohlenhamer nun einmal Hilfe im Hause brauchte, so ging er beileibe nicht zu seinem nÄchsten Nachbar, dem Ermansperger, sondern eine schÖne Strecke weiter fort, und der Ermansperger machte es seinerseits ebenso. NatÜrlich herrschte die gleiche KÄlte auch zwischen ihren Weibern und Kindern, ihren MÄgden und Knechten, ihren Vettern und Basen, — ja sogar die Hofhunde hatten zuletzt den Groll in den Nasen und knurrten aufeinander! Brave MÄnner versuchten oftmals, die starren StreithÄnse auszusÖhnen, aber vergebens. »GehÖrt mir doch die Fichte allein!« sagte jedesmal der Dohlenhamer mit stechenden Augen und verbissenen Lippen. Aber ebenso sprach auch der Ermansperger. So wurden denn die Friedenstifter ihrer Liebesdienste endlich mÜde. Obgleich die beiden HartnÄckigen, wie gesagt, nicht im Dorf wohnten, so zog ihr Streit doch immer weitere Kreise, bis zuletzt auch mancher mit hineingeriet, der es gern vermieden hÄtte. So ging es einst dem derben Hufschmied, und als er sich nicht mehr zu helfen wußte, brach er in die zornigen Worte aus: »Wenn doch nur einmal das Donnerwetter in die vermaledeite Grenzfichte schlÜge!« Aber Jahr um Jahr verging. Ein Gewitter nach dem andern zog wie sonst ohne Blitzschlag Über Dorf und HÖhe dahin, und die herrliche Fichte streckte ihre Äste immer hÖher, immer breiter aus. Nun schrieb man das Jahr 1845. Das Gesinde der beiden GroßhÖfe war auf den anstoßenden Feldern mit dem Binden der Erntegarben beschÄftigt. Die feindlichen Bauern selbst standen beaufsichtigend unter ihren Leuten. Von Zeit zu Zeit warfen sie, der Dohlenhamer von rechts, der Ermansperger von links, einen begehrlichen Blick hinauf zur Fichte und dann eine finster grollende Miene hinÜber zum Nachbarn. Das Gesinde merkte es und blinzelte mit hÄndellÜsternen Gesichtern; zugleich aber beeilten sich alle unter dem kalten, scharfen Blick ihrer Herren, denn aus Nordwest zogen Über das wellige Gebirge rabenschwarze Wetterwolken heran. Schon standen die Weizengarben in Reih’ und Glied aufgerichtet. »So! Jetzt heim! Geschwind!« befahl hÜben der Ermansperger und drÜben der Dohlenhamer. Aber Die beiden Großbauern standen starr vor Schrecken und bekreuzten sich. Dann traten sie zur Grenzfichte heran und blickten erstaunt in das Werk des feurigen Schiedsrichters. »Da liegt nun, was jedem gehÖrt!« sagte der Dohlenhamer ernst und streckte seinem Nachbarn die Hand hin. »Das war der drohende Finger Gottes: unser Streit ist entschieden!« sprach der Ermansperger sichtlich bewegt und ergriff die dargebotene Rechte. »Da hat der Blitz den Richter gemacht!« erzÄhlten sich nun alle und dachten dabei an die Worte des Dorfschmieds. Noch heute aber lebt das seltsame Gewitter fort im GedÄchtnis und Munde des Volks, das Ermansperg und Dohlenham umwohnt. Joseph Schlicht. Es regnete, was vom Himmel herunterwollte. Die Tannen schÜttelten den Kopf und sagten zueinander: »Wer hÄtte am Morgen gedacht, daß es so kommen wÜrde!« Es tropfte von den BÄumen auf die StrÄucher, von den StrÄuchern auf das Farnkraut und lief in unzÄhligen kleinen BÄchen zwischen dem Moose und den Steinen. Am Nachmittag hatte der Regen angefangen, und nun wurde es schon dunkel, und der Laubfrosch, der vor dem Schlafengehen noch einmal nach dem Wetter sah, sagte zu seinem Nachbar: »Vor morgen frÜh wird es nicht aufhÖren.« Derselben Ansicht war eine Ameise, die bei diesem Wetter durch den Wald mußte. WÄhrend sie so sprach, sah sie gerade vor sich in der DÄmmerung einen großen Pilz. Freudig ging sie darauf zu. »Das paßt,« rief sie, »das ist ja ein Wetterdach, wie man es sich nicht besser wÜnschen kann. Hier bleib’ ich, bis es aufhÖrt zu regnen. Wie es scheint, wohnt hier Das tat sie denn auch. Sie war eben daran, das Regenwasser aus den Schuhen zu gießen, als sie bemerkte, daß draußen eine kleine Grille stand, die auf dem RÜcken ihr Violinchen trug. »HÖr’, Ameischen,« hub die Grille an, »ist es erlaubt, hier unterzutreten?« »Nur immer herein!« erwiderte die Ameise. »Es ist mir lieb, daß ich Gesellschaft bekomme.« »Ich habe heute«, sagte die Grille, »im Heidekrug zur Kirmes aufgespielt. Es ist ein bißchen spÄt geworden, und nun freue ich mich, daß ich hier die Nacht bleiben kann, denn das Wetter ist ja schrecklich, und wer weiß, ob ich noch ein Wirtshaus offen finde.« Also trat das Grillchen ein, hing sein Violinchen auf und setzte sich zu der Ameise. Noch nicht lange saßen sie da, so sahen sie in der Ferne ein Lichtchen schimmern. Wie es nÄher kam, erkannten sie es als ein Laternchen, das ein JohanniswÜrmchen in der Hand trug. »Ich bitt’ euch,« sagte das JohanniswÜrmchen hÖflich grÜßend, »laßt mich die Nacht hier bleiben! Ich wollte eigentlich nach Moosbach zu meinem Vetter, habe mich aber im Walde verirrt und weiß weder aus noch ein.« »Nur immer zu!« sagten die beiden. »Es ist recht gut fÜr uns, daß wir Beleuchtung bekommen.« Gern folgte Der Schein des Lichts fÜhrte ihnen bald einen Wanderer zu, der ziemlich ungeschickt Über Laub und Moos herangestolpert kam. Es war ein KÄfer von der großen Art. Ohne »Guten Abend« zu sagen, trat er ein. »Aha!« rief er, »so bin ich doch recht gegangen, und dies ist die Zimmergesellenherberge.« Mit diesen Worten setzte er sich, holte seinen Schnappsack hervor und begann sein Abendbrot zu verzehren. »Ja, ja,« sagte er, »wenn man den ganzen Tag Über Holz gebohrt hat, dann schmeckt das Essen!« Als er fertig war, stopfte er sich seine Pfeife, ließ sich vom JohanniswÜrmchen Feuer geben, zÜndete an und fing an, ganz gemÜtlich zu rauchen. »Das nenne ich laufen!« rief sie. »Wie bin ich gejagt! Ordentlich das Seitenstechen hab’ ich bekommen. Ich will nur gleich bemerken, daß ich im nÄchsten Dorfe eine Bestellung zu machen habe, die Eile hat. Aber niemand kann Über seine KrÄfte, besonders wenn er sein Haus mitschleppen muß. Wenn die Gesellschaft erlaubt, will ich hier ein Niemand hatte etwas dagegen, daß sich die Schnecke ein gemÜtliches PlÄtzchen aussuchte. So waren nun die fÜnfe da versammelt, als die Ameise das Wort nahm und also sprach: »Warum sitzen wir hier so trÜbselig beieinander und langweilen uns, da wir uns doch die Zeit auf angenehme Weise verkÜrzen kÖnnten? Ich habe daran gedacht, daß wir uns Geschichten erzÄhlen sollten, und gern wÜrde ich selbst den Anfang machen, wenn ich nur eine recht hÜbsche Geschichte wÜßte. Nun ist mir aber eben etwas noch Besseres eingefallen. Ich sehe, daß die Grille ihr Violinchen bei sich hat. Wenn sie nicht gar zu mÜde ist, mÖchte ich sie bitten, uns ein lustiges StÜckchen zu spielen, damit wir eins tanzen kÖnnen.« Dieser Vorschlag der Ameise fand allgemeinen Beifall. Die Grille ließ sich auch nicht lange nÖtigen, sondern stellte sich sogleich mit ihrem Violinchen in die Mitte und spielte das lustigste TÄnzchen herunter, welches sie auswendig wußte, wÄhrend die anderen um sie herumtanzten. Nur die Schnecke tanzte nicht mit. »Ich bin«, sagte sie, »nicht gewÖhnt an das schnelle Herumwirbeln; mir wird zu leicht schwindelig. Aber tanzt, soviel ihr wollt! Ich sehe mit VergnÜgen zu und mache meine Bemerkungen.« Die anderen ließen sich denn auch gar nicht stÖren, sondern ju Aber ach, durch welch ein furchtbares, ungeahntes Ereignis wurde ihr Fest plÖtzlich unterbrochen! Der Pilz, unter welchem die lustige Gesellschaft tanzte, gehÖrte leider einer alten KrÖte. An schÖnen Tagen saß sie oben auf dem Dache, wie die KrÖten zu tun pflegen; trat aber schlecht Wetter ein, so kroch sie unter den Pilz, und es konnte ihretwegen regnen von Pfingsten bis Weihnachten. Diese KrÖte nun war am Nachmittag nach dem nÄchsten Moor zu ihrer Base, einer Unke, gegangen, und sie hatten sich bei Kaffee und Napfkuchen so viel erzÄhlt, daß es darÜber dunkel geworden war. Jetzt am Abend kam die KrÖte ganz leise nach Hause geschlichen. Über dem Arm hatte sie ihren Arbeitsbeutel hÄngen, und in der Hand trug sie einen roten Regenschirm mit messingener KrÜcke. Als sie den Jubel in ihrem Hause hÖrte, trat sie noch leiser auf. So kam es, daß die Leutchen drinnen sie nicht eher gewahr wurden, als bis sie mitten unter ihnen stand. Das war eine unerwartete StÖrung! Der KÄfer fiel vor Schreck auf den RÜcken, und es dauerte fÜnf Minuten, ehe er wieder auf die Beine kommen konnte. Das JohanniswÜrmchen dachte zu spÄt daran, daß es sein Laternchen hÄtte auslÖschen sollen, um in der Dunkelheit zu entwischen. Die Grille ließ mitten im Takt ihr Violinchen fallen, die Ameise sank aus einer Ohnmacht in die andere, und selbst die Das Abenteuer im Walde. Nun hÄttet ihr aber hÖren sollen, wie die KrÖte die armen Leute heruntermachte! »Sieh einmal an,« rief sie zornig und schwang ihren Regenschirm, »da hat sich ja ein schÖnes Lumpengesindel zusammengefunden! Ist das hier eine Herberge fÜr Landstreicher und Dorfmusikanten? Ich sag’ es ja, nicht aus dem Haus kann man gehen, gleich ist der Unfug los! Augenblicklich packt ihr jetzt eure Siebensachen ein, und dann fort mit euch, oder ich will euch schon Beine machen!« Was war zu tun? Die armen Leute wagten gar nicht, sich erst aufs Bitten zu legen, sondern nahmen still ihre Sachen auf, riefen der Schnecke durchs SchlÜsselloch zu, daß sie mitkommen solle, und als auch diese sich fertig gemacht hatte, zogen sie alle miteinander von dannen. Das war ein klÄglicher Auszug! Voran das JohanniswÜrmchen, um auf dem Wege zu leuchten, dann der KÄfer, dann die Ameise, dann das Grillchen und zuletzt die Schnecke. Der KÄfer, der eine gute Lunge hatte, rief von Zeit zu Zeit: »Ist hier kein Wirtshaus?« Aber alles Rufen war vergeblich. Als sie ein StÜck gegangen waren, merkten sie, daß die Die andern zogen betrÜbt weiter, und nach langem Umherirren fanden sie unter einer Baumwurzel ein leidlich trockenes PlÄtzchen. Da brachten sie die Nacht zu unter großer Unruhe und ohne viel zu schlafen. Waren sie auch mit heiler Haut davongekommen, so blieb es doch immerhin ein schlimmes Abenteuer, und die mit dabeigewesen sind, werden daran denken, solange sie leben. Johannes Trojan. In der NÄhe meines Heimatdorfes, eine kleine halbe Stunde bergaufwÄrts, befand sich eine schmale WaldblÖße, durch welche ein Bach dahinrauschte. Dort lagen TrÜmmer aller Art umher, Nur einer machte hiervon eine Ausnahme, das war mein Großvater. Der stak voll alter Geschichten und MÄren und war ein nachdenklicher Mann; was man ihn auch fragen mochte, er wußte Bescheid. Dann erzÄhlte er, wie alles gewesen, und kannte und nannte es bei Ort und Namen und Zeit, und das tat er immer in seiner eigenen, wunderlichen Weise, die einem jeden zu Herzen ging. Einmal fragte ich ihn, warum man denn den Ort »WodansmÜhle« heiße, da doch nirgends eine MÜhle zu sehen sei. »Dinge und Menschen vergehen,« sagte der alte Mann, »aber Namen bleiben. Doch du sollst wissen, wie es mit der MÜhle war, denn eine MÜhle hat hier wirklich einmal gestanden. Wie kÄme sonst der MÜhlstein in den Wald? MÜhlsteine, die wild wachsen, gibt es nicht. Also hÖre zu! In uralten Zeiten war drunten noch kein Dorf. Ein jeder baute sein Haus fÜr sich mitten in das Feld hinein, das ihm gehÖrte, damit er alles hÜbsch nahe und beisammen habe und nicht so viele Schritte zu tun brauche. So wohnten die Bauern einzeln und verstreut Über das ganze Land hin, gerade wie die FÜchse und Dachse in ihren Gruben. Aber ein Haus gab es, wo jetzt unser Dorf steht, das war Auch Über mancherlei neue und geheime KÜnste berichtete man, die jenseits des Rheinstroms oder der Alpen von fremden, dunkelhaarigen VÖlkern geÜbt wurden. Seltsame Werkzeuge, Waffen und MÜnzen waren da zu sehen, welche man in Tausch und Kampf mit den Fremden als kostbare SchÄtze oder Gedenkzeichen davongetragen hatte. Bei all solchen Gelegenheiten horchte der Schmied wohl auf, vernahm, was gesagt, und betrachtete, was gezeigt wurde, offenen und nachdenklichen Sinnes, wie ein verstÄndiger Mann es tut, und machte sich Über alles seine eigenen Gedanken. So wÄhrte das Leben in Werkstatt und Herberge den ganzen FrÜhling und Sommer hindurch, bis unwegsames Wetter im SpÄtherbst den Verkehr hemmte, und bis der schweigsame Schnee die weiten Lande in eine In einer wilden MÄrznacht nun, als der Schnee bereits am Schmelzen war, lag einmal der Schmied auf seinem Lager und lauschte im Einschlafen auf das schurrende GerÄusch der SteinblÖcke, die der ÜberschÄumende Bach zu Tal schob. Da drang es plÖtzlich an sein Ohr wie Heulen und Brausen. Erst unbestimmt und aus weiter Ferne, aber rasch sich nÄhernd, wie auf Fittichen des Sturmes, schwoll es an zu einem entsetzlichen, hohlen und tiefen GetÖse, untermischt mit Pfeifen, StÖhnen und einzelnen wilden Schreien. Dazwischen erklang es wie das langgezogene nÄchtliche Geheul von Hunden und wie dumpfdrÖhnender Hufschlag. Der Schmied war starr vor Entsetzen. Es war, als ob der LÄrm durch alle LÜcken des Hauses hereindrÄnge und an allen TÜren rÜttelte, als ob grÄßliche Stimmen durch die Esse herabriefen. Da, mit einem Schlage, hÖrte alles auf, es ward eine Weile totenstill, aber gleich darauf erscholl vom Hoftor her ein lautes, ungestÜmes Pochen und der herrische Ruf: ‚Auf da! Mach’ auf!‘ Der Schmied sprang von seinem Lager, eilte ans Tor und schob die schweren Riegel zurÜck. Da erblickte er beim ungewissen Widerschein des Schnees eine stolze, hochragende ‚Mein Gaul hat ein Eisen gebrochen beim schnellen Ritt,‘ redete ihn der nÄchtliche Reiter mit tiefdrÖhnender Stimme an, ‚und du sollst ihn mir frisch beschlagen. Aber spute dich, denn mein Weg ist noch weit!‘ Damit nahm er den Schimmel beim Kopf und fÜhrte ihn in den Hof vor die Schmiede. Nun begann der Schmied seinen Vorrat von Hufeisen von den PflÖcken herabzunehmen, aber alle erwiesen sich als viel zu klein. ‚Nimm dein Werkzeug und schmiede mir ein neues!‘ rief der Reiter ungeduldig. ‚Wie du es schmiedest, wird’s recht.‘ Schweigend machte sich der Schmied an die Arbeit, schÜrte das Feuer, fachte es mit dem großen Blasbalg aus Bockshaut an und schmiedete drauf los, daß die Funken weit umherstoben: das Hufeisen paßte wie angegossen. ‚Du bist ein wackerer Meister mit dem Hammer,‘ sagte der fremde Reiter, als der Schmied das Eisen heiß aufgenagelt hatte, ‚aber ein unweiser Mann. Weshalb fragst du nicht?‘ ‚Herr,‘ entgegnete der Schmied demÜtig, ‚meine VÄter haben mich gelehrt, daß es weise sei, bei der Arbeit zu schweigen und vorlaute Fragen zu meiden, denn dieses sei die Art der Weiber. Da Ihr mir aber eine Frage freistellt, so sagt mir, woher Ihr kommt zu so ungewohnter Stunde, und wohin Eure Fahrt geht!‘ ‚Ich komme heint von der Friesen Strand Und fahre stracks ins BÖhmerland!‘ erwiderte der Reiter. ‚Bis gestern bin ich auf Schiffen gewesen; nun muß ich mich wieder ans Roß gewÖhnen.‘ ‚Wer seid Ihr, Herr?‘ war des Schmieds zweite und erstaunte Frage. ‚Der schnellste Renner wÜrde ja zu diesem Ritt mehr als sieben Tage brauchen!‘ Der Reiter lachte. Er warf dem Schmied das alte, zerbrochene Hufeisen hin, sprang auf den RÜcken seines Schimmels und rief: ‚Da hast du deinen Lohn! Und damit du weißt, wessen Roß du beschlagen: ich bin der Wode, der mÄchtige FÜhrer des Geisterheeres, und brause in Sturm und Wetter Über See und Land, wo man Schlachten schlÄgt, und wo MÄnner fallen auf drÖhnender Walstatt!‘ Bei diesen Worten hufte sein Roß, sprang Über die sieben Ellen hohe Hofmauer und verschwand in der dunklen Nacht. Zugleich aber erhob sich von neuem das wilde, grausige GetÖse. Erde und Luft, bis zu den tiefstreichenden Wolken hinan, wimmelten von gespenstischen Gestalten, die in rasendem Ritte vorÜbersausten. Voran Weiber zu Roß mit wehenden Haaren, hinterher bleiche Krieger, die aus offenen Wunden bluteten. Heulend sprangen Hunde dazwischen mit funkelnden Augen und lechzenden Zungen, von denen feuriger Geifer floß, und darÜber flatterten Raben mit rauhem GekrÄchze. Immer neue, wilde Gestalten tauchten auf und drÄngten und schoben einander in eiligem Zuge, Als er zu sich kam, war es heller Morgen, und der nÄchtliche Spuk erschien ihm wie ein Traum. Da sah er neben sich etwas in der Sonne blinken. Es war das gebrochene Hufeisen, das ihm der Wode als Lohn zugeworfen hatte, und als er es aufhob, siehe! da war es von gediegenem Golde. Nun wußte er, daß er den gewaltigen Gott der Schlachten und toten Heerscharen, den weisen Zauberer und Wanderer mit seinem wÜtenden Gefolge selbst gesehen hatte, und verwahrte sein goldenes Hufeisen zum Andenken an das nÄchtliche Abenteuer. Bald darauf aber drang auch die Kunde ins Land, daß vier Tage nach jener Nacht im BÖhmerlande eine blutige Schlacht geschlagen worden sei. Als der FrÜhling wiederkehrte und die liebe Sonne die Straßen wieder getrocknet und wegsam gemacht hatte, nahm eines Abends ein fremder Mann Herberge in der Schmiede. Dieser fÜhrte mancherlei dem Schmied unbekanntes Werkzeug mit sich und sagte, er reise an den Hof eines KÖnigs, um dort neue Kunst auszuÜben. Da nun der Schmied ihn fragte, wozu all das seltsame GerÄt nÜtze sei, erzÄhlte ihm der Fremde von einer neuen Art, KÖrner zu mahlen. ‚Eure Weiber‘, sprach er, ‚sind Übel daran, denn sie haben viel MÜhe, jeden Tag genÜgend Getreide in ihren HandmÜhlen zu zerquetschen. Bei uns zu Hause dagegen schÜtten die Leute das Korn einfach zwischen zwei große, runde Steine, die sich schnell aufeinander drehen, nicht von Menschenkraft getrieben, sondern von der Gewalt der SturzbÄche und mittels eines Wasserrads. Das schafft anders, kann ich Euch sagen. Ein Bauer braucht nur einige Tage, um fÜr das ganze Jahr seinen Vorrat von feinstem Mehl zu mahlen. Weise MÄnner aber wissen zu berichten, diese neue Kunst stamme von dem mÄchtigen Gotte Wodan, auch Wode oder Wanderer geheißen, der ein großer Zauberer ist und aller Kunst und Weisheit Meister.‘ Sobald der Schmied dies vernahm, erzÄhlte er dem Fremden, wie er kÜrzlich den Gott leibhaftig gesehen und seinen Schimmel beschlagen habe, und zeigte zum Beweise das goldene Hufeisen vor. Da er nun aber auch ein kluger und unternehmender Mann war, der gern aus allem Neuen, wenn es gut war, Nutzen zog, so ward er mit dem Fremden handelseinig, daß er ihm eine MÜhle bauen solle, und zwar ganz nach der Art, wie Wodan es die Menschen gelehrt habe. Zum Lohn dafÜr versprach er ihm des Gottes Hufeisen. Am andern Tage zogen die beiden den Bach entlang bergaufwÄrts, und der Fremde hielt die Stelle, wo das Wasser ein so starkes GefÄlle hat, fÜr die geeignetste zu seinem Werk. SpÄterhin, als fremde Horden aus Osten in diese Gegend hereinbrachen und die einzelgelegenen BauernhÖfe plÜnderten und verwÜsteten, fanden die Leute, daß es besser sei, sich zusammenzusiedeln und in DÖrfern beieinander zu wohnen, Da ist denn ein Streit entstanden, ob sie sich um die Schmiede oder um die MÜhle anbauen sollten. Endlich ist ein alter, erfahrener Mann aufgestanden, der war klÜger als alle anderen miteinander und hat gesagt: ‚Die MÜhle brauchen wir nur einmal im Jahre, zu der Zeit, wo unser Korn reif ist; aber die Schmiede brauchen wir alle Tage. Laßt uns also das Dorf um die Schmiede bauen!‘ Und so ist es denn auch geschehen, und die Schmiede steht noch heute mitten im Dorfe, wie es recht und billig ist.« Rudolf Vogel. Vor lÄngerer Zeit hielt ich mich einige Jahre hindurch in einer kleinen Stadt auf und war dort an einen alten Herrn empfohlen, der ein Studiengenosse meines Vaters gewesen war. In dem Hause dieses Mannes ging ich aus und ein und genoß dort viel Freundlichkeit. Am Ende des Gartens befand sich auf einer kleinen ErhÖhung eine mÄchtige Lindenlaube, die sich auf den stillen, von Schilf und Weiden umkrÄnzten See Öffnete, und dort saß ich eines schÖnen Abends im August in heiterem GesprÄch mit dem alten Herrn, der an jenem Tage besonders aufgerÄumt war. Vor uns auf dem Tische stand eine mÄchtige Schale mit kÖstlichen Pfirsichen, Reineclauden und Aprikosen, in den GlÄsern schimmerte eine vorzÜgliche Sorte von Rheinwein, und ringsum ertÖnte in den stillen Abend hinein das frÖhliche GetÖse spielender Kinder, der Enkel und Enkelinnen meines Gastfreundes. Unter diesen war ein zwÖlfjÄhriger Junge, der sich durch große kÖrperliche Gewandtheit auszeichnete. PlÖtzlich hÖrten wir dessen Stimme aus dem Wipfel eines Baumes, der seine Zweige wagerecht nach dem Ufer des Sees hinausstreckte. »Großvater!« rief der Junge, »nun passe mal auf, wie ich es jetzt schon gut kann!« Damit war er auf einen der wagerechten Zweige hinausgerutscht und hing plÖtzlich an den Knien daran, mit dem Kopfe nach unten. Zu meinem Schreck ließ er sich dann »Gut, mein Sohn,« rief Herr Lindow, »kannst mal herkommen!« Nachdem er den Knaben fÜr seine Leistung reichlich mit Obst belohnt hatte, wandte er sich zu mir und sagte: »Welcher Art war dieser Dienst?« fragte ich etwas verwundert. Der Doktor lehnte sich in seinen Gartenstuhl zurÜck und sah sinnend vor sich hin wie einer, der sich eine Geschichte im Geiste zurechtlegt, und sagte dann: »Sie wissen doch, daß ich als Student zu zehnjÄhriger Festungshaft verurteilt worden bin?« »Ja, gewiß!« antwortete ich. »Damals, als auch Fritz Reuter zu dieser Strafe verdammt wurde, und aus denselben GrÜnden.« »Gewiß,« fuhr Lindow fort, »allein ich hatte es in einer Hinsicht besser als Reuter, da ich meine Zeit in der einzigen kleinen Festung meines engeren Vaterlandes absitzen durfte, wo ich es verhÄltnismÄßig gut hatte. Diese war nun Ich war der einzige Festungsgefangene dort, denn mehr dergleichen politische Verbrecher hatte das kleine FÜrstentum nicht hervorgebracht, und man ließ mir am Tage ziemlich viel Freiheit, doch wurde ich nachts sorglich eingeschlossen. Wie sollte ich auch entkommen? An drei Seiten fiel der Felsen wohl an die hundert Fuß steil ab, und an der vierten, wo sich zwar ein Weg ins Tal hinabschlÄngelte, war mir der Ausgang durch hohe Mauern und mÄchtige Tore mit Schildwachen davor genÜgend versperrt. Über Mangel an Aussicht konnte ich mich an diesem Orte freilich nicht beklagen, denn der Felsen war ein letzter AuslÄufer des am Horizonte dÄmmernden Gebirges und lag als einzige wesentliche ErhÖhung in einer sanft gewellten Ebene. Aber nichts ist wohl geeigneter, die Sehnsucht nach der Freiheit zu verschÄrfen, als ihr steter, ungehinderter Anblick. Und an schÖnen Sommersonntagen wurde diese Sehnsucht fast zum kÖrperlichen Schmerz in mir, denn an solchen krabbelten auf allen Wegen die Menschen aus dem StÄdtchen hervor in die freie Natur, wie Ameisen aus Als nun dies alles wieder einmal an einem gewissen Sommersonntag geschah, da glaubte ich’s nicht mehr ertragen zu kÖnnen und begab mich auf die entgegengesetzte Seite des Felsens, wo mir der Anblick der Stadt und das frÖhliche GetÜmmel um sie her gÄnzlich entzogen war. Hier strÖmte aus der weiten HeideflÄche ein Fluß dicht an die eine Wand des Felsens heran und bildete mit diesem einen Winkel, in welchem ich gerade unter mir den großen Garten eines wohlhabenden Fabrikanten sah, und etwas weiter entfernt dessen Landhaus. Deutlich wie eine gut gezeichnete Landkarte lag der Garten mit seinen sauberen Steigen, RasenflÄchen und GebÜschgruppen unter mir, aber auch ebenso leblos wie eine Landkarte war er meist, So saß ich nun dort an jenem Sonntagnachmittag, ließ meine Beine Über den Rand des Felsens baumeln und schaute abwechselnd in die saubere grÜne Einsamkeit zu meinen FÜßen und dann Über den Fluß hinweg auf die eintÖnige Heide. Da Überkam mich mit einemmal ein Gedanke, der mein Gehirn mit einem solchen Rausch erfÜllte, daß ich mich zurÜcklehnte und meine HÄnde in das Gras klammerte aus Furcht, von einem Schwindel ergriffen zu werden und plÖtzlich hinabzustÜrzen. Es stand nÄmlich in dem letzten Winkel des Gartens ein uralter Lindenbaum, und zwar so nahe an dem Felsen, daß seine Zweige diesen fast berÜhrten. Seine ungeheure grÜne Kuppel wogte gerade unter mir, die Entfernung konnte nicht mehr als zwanzig Fuß betragen. Sonderbar, daß mir dies bisher nie so aufgefallen war wie jetzt! Wenn ich in den Baum hineinsprang, war ich ja so gut wie unten. Es hatte auch gar keine Gefahr, denn die dichtbelaubten, elastischen Zweige wÜrden mich sanft aufnehmen und den Sturz mildern, und dann: wie oft hatte ich mich nicht als Knabe so von Zweig zu Zweig absichtlich aus BÄumen fallen lassen! Das war eine Kunst, die gefÄhrlicher aussah, als sie war, und mir schon oftmals den Beifall erstaunter Zuschauer eingebracht hatte. Wenn ich das hier ausfÜhrte, Aber wie lange? Ich war ohne Mittel, denn genÜgendes Geld bekam ich als Gefangener natÜrlich nicht in die HÄnde, und obwohl die Landesgrenze nicht allzuweit entfernt war, so wÄre mir die Flucht doch wohl nur in einem bereitstehenden Wagen mit schnellen Pferden gelungen. Auch fehlten mir Legitimationspapiere, und diese waren hÖchst nÖtig, um mich an der Grenze auszuweisen. Woher dies alles nehmen? Doch diese Gedanken kamen mir alle erst spÄter bei ruhiger Überlegung; zunÄchst berauschte mich der Gedanke, wie leicht ich entkommen konnte, wenn ich wollte, so sehr, daß ich fÖrmlich in ihm schwelgte. Falls ich dort hinabsprang und mich von Zweig zu Zweig stÜrzen ließ, war Gefahr nur dann vorhanden, wenn sich zu große LÜcken zwischen den Ästen fanden, oder wenn diese in bedeutender HÖhe vom Boden aufhÖrten. Ich suchte mir einen anderen Ort auf dem Felsen, legte mich dort auf den Bauch und betrachtete die Linde ans grÖßerer Entfernung von der Seite. Sie war so normal gewachsen, wie dies fÜr einen Musterbaum ihrer Art nur mÖglich ist, die grÜne Kuppel zeigte keinerlei Unterbrechung, und die untersten Zweige hingen bis auf den Boden hinab. PlÖtzlich ertÖnten stramme, taktmÄßige Tritte und riefen mich aus meinen Gedanken zurÜck. Der Posten, der in Im Geiste aber war ich bei meinem alten Lindenbaum. Ich stand am Rande des Felsens und suchte mit dem Fuße nach einem sicheren Absprung. Nun war es so weit. Los! Mich schauderte zwar ein wenig, aber es mußte sein. Wie mir das grÜne Laubwerk um die Ohren sauste! Ich war gerade richtig gesprungen, der Ast gab mÄchtig nach, aber er brach nicht. Ich ließ ihn nicht los, bis er sich tief auf den nÄchsten gebeugt hatte, und dann rauschte und rutschte ich durch die knickenden kleineren Zweige tiefer und tiefer von einem Aste zum anderen und schnell war ich unten. Jetzt hinab an den Fluß und durch die seichten SommergewÄsser an das andere Ufer! Hier das kleine KieferngehÖlz verbarg mich einstweilen. Aber ich mußte weiter, — weiter Über freie RÄume, wo ich fernhin sichtbar war. Nur immer vorwÄrts der Grenze zu! Vielleicht bemerkte mich doch niemand. Ein FlÜchtling muß GlÜck haben. Da: ‚Bum!‘ Was war das? Ein Alarmschuß von der Festung! Nun ging die Hetzjagd an. So sehr hatte ich mich in diese Gedanken vertieft, daß es Von nun ab ließ mich der Fluchtgedanke aber nicht mehr los, und sooft ich es nur ohne Aufsehen zu tun vermochte, studierte ich meinen alten Lindenbaum, bis ich ihn zuletzt fast auswendig konnte. Den verhÄngnisvollen Sprung habe ich im Geiste so oft gemacht, daß es nicht zu zÄhlen ist. Dabei zermarterte ich mich mit GrÜbeleien, wie ich mir Geld und alles sonst zur Flucht NÖtige verschaffen mÖchte, verwarf einen Plan nach dem anderen und kam zu keinem Ende damit. Denn alles hing davon ab, daß ich Briefe sicher aus der Festung befÖrderte, und ich fand niemand, dem ich mich hÄtte anvertrauen mÖgen. Indes war die Zeit der Sommerferien fÜr die Schulkinder gekommen, und als ich eines Tages wieder in den sonst so verlassenen Garten des Landhauses hinabschaute, bemerkte ich dort eine wundervolle VerÄnderung. Was mir an weiblichen Wesen auf der Festung zu Gesicht kam, war nicht dazu angetan, mich zu verwÖhnen, denn es gehÖrte zu der Gattung der RegimentsmegÄren und Scheuerdrachen; deshalb erschien mir wohl das junge, etwa siebzehnjÄhrige MÄdchen dort unten wie ein Wunder von SchÖnheit und lieblicher Bildung, und es erfÜllte mich etwas wie Dankbarkeit gegen den SchÖpfer, der solche WÄhrend das junge MÄdchen, langsam alles betrachtend, durch den Garten ging, wurde sie von einem ungefÄhr vierzehnjÄhrigen Knaben umschwÄrmt, der mit einem Bogen von Eschenholz leichte Rohrpfeile in die Luft schoß und sich an ihrem hohen Fluge vergnÜgte. Durch einen Zufall stieg einer dieser Pfeile bis zu mir empor und fiel neben mir nieder. Dadurch wurde der Knabe meiner gewahr und machte seine Schwester auf mich aufmerksam. Ich nahm meinen Hut ab und warf, indem ich grÜßte, den Pfeil wieder hinunter. Mein Schicksal und meine Anwesenheit auf der Festung waren in der ganzen Stadt bekannt, und so mochten diese jungen Leute auch wohl gleich wissen, wen sie vor sich hatten. Denn sie sprachen miteinander und sahen zu mir empor, der Knabe unverhohlen und voll Neugier, das MÄdchen flÜchtiger, aber, wie es mir schien, mit einem Ausdruck von Mitleid in den schÖnen ZÜgen. Da ich nun fortwÄhrend mit Fluchtgedanken beschÄftigt war und alles, was mir passierte, mit diesen in Zusammenhang brachte, so fiel mir auch jetzt sogleich ein, daß sich hier eine Gelegenheit biete, wieder mit der Außenwelt in Verbindung zu treten. Wenn das schÖne MÄdchen mir vielleicht auch nicht helfen konnte, so wÜrde sie doch gewiß nicht einen armen Gefangenen verraten, der sich vertrauensvoll in ihre Hand gab. Aber ein Zweifel fing sofort an mich zu plagen, Als ich gegen Abend wieder in meine Zelle eingeschlossen wurde, schrieb ich alles sorgfÄltig auf und setzte die Mittagsstunde von zwÖlf bis ein Uhr zu einer Antwort von ihrer Seite fest. Um diese Zeit befanden sich auf der Festung alle beim Essen, und ich wurde folglich am wenigsten beobachtet. Auch pflegte sich dann die Schildwache in meiner NÄhe einer stillen, innerlichen Beschaulichkeit hinzugeben. Ihre Antwort sollte das MÄdchen auf ein Zettelchen schreiben, dieses mit ein wenig Wachs oder Pech an einen Rohrpfeil kleben und durch ihren Bruder zu mir hinaufschießen lassen. Mit fieberhafter Spannung wartete ich am anderen Tage darauf, daß die SchÖne wieder im Garten erschiene, doch vergebens: alles blieb leer. Nur der Knabe tollte eine Weile dort herum und Übte sich mit langen, schlanken Gerten, die er als Wurfspieße benutzte. Endlich, am Nachmittag, sah ich das helle Kleid aus dem GrÜn hervorleuchten. Das MÄdchen ging langsam durch den Garten und verschwand unter dem alten Lindenbaum. Es dauerte eine Ewigkeit, bis sie wieder zum Vorschein kam, nun aber wandelte sie auf dem Steige unter mir hin. Jetzt galt es. Beinahe hÄtte ich laut aufgejauchzt, als ich dies bemerkte, und den ganzen Abend hatte ich die grÖßte Not, die außerordentliche Heiterkeit zu unterdrÜcken, die mich erfÜllte. Am anderen Tage ging alles gut. Der Knabe kam und schoß mit seinen Rohrpfeilen wie zur Übung an dem Felsen in die HÖhe. Dann nahm er einen anderen Pfeil, zielte sorgfÄltig und schoß ihn zu mir empor. Es war zu kurz: ich sah den leichten Boten bis dicht an meine Hand steigen und dann wieder zurÜcksinken. Das zweite Mal aber gelang es; ich lÖste schnell den kleinen, schmalen Zettel ab und warf den Pfeil wieder hinunter. Sie schrieb: ‚Ich will alles tun, was ich kann. Mein Onkel will mir dabei helfen. Sie dÜrfen ihm vertrauen, wie auch meinem Bruder Paul, der alles weiß und stolz auf dies Geheimnis ist. Haben Sie guten Mut! In vierzehn Tagen kann alles bereit sein.‘ Diesen kleinen Zettel drÜckte ich an meine Lippen, las ihn wohl hundertmal und bewahrte ihn als meinen grÖßten Schatz. Über die nÄchsten vierzehn Tage will ich kurz hinweggehen. Genug, die Stunde war da, wo alles bereit war, und zwar sollte die Flucht am hellen Mittage stattfinden. Das GlÜck begÜnstigte mich in jeder Hinsicht. Am Vormittage stieg ein Gewitter auf; Über der Heide stand eine blauschwarze Wolkenwand, in der die Blitze zuckten, und der Donner ertÖnte lauter und lauter. Einige Minuten nach zwÖlf stand ich an dem Rande des Felsens und wartete auf den nÄchsten Donner, der das GerÄusch meines Sturzes ÜbertÄuben sollte. Da zuckte ein greller Blitz auf. ‚Eins, zwei, drei, vier, fÜnf, sechs, sieben, acht...‘ zÄhlte ich unwillkÜrlich, und dann knatterte und rollte es mÄchtig in den Wolken. ‚In Gottes Namen!‘ sagte ich innerlich und sprang zu. Wie ich hinuntergekommen bin, weiß ich noch heute nicht. Es donnerte, rauschte und sauste mir um die Ohren, Zweige schlugen mir ins Gesicht, und mit einem Male hatte ich Boden unter den FÜßen. Ich eilte schnell durch Doch ich mußte weiter. Auf der Straße sah ich den Knaben Paul, dem ich in einiger Entfernung folgen sollte. Er fÜhrte mich zu einem kleinen GehÖlz in der NÄhe, wo eine Kutsche mit zwei schÖnen Pferden hielt. Ein Ältlicher Mann, der dabeistand, schob mich hinein und rief mir zu: ‚Im Wagenkasten ist ein neuer Anzug und was Sie sonst noch brauchen, in der Seitentasche Geld und Papiere. Reisen Sie mit Gott!‘ Ich wollte ihm danken, allein die Pferde zogen an, und fort ging’s in Sturm und Regen und rollendem Donner, was die GÄule laufen konnten. Nun, ich kam nach allerlei kleinen Abenteuern Über die Grenze und weiter und war frei. Frei und doch wieder gefangen, denn den Kuß am Gartentor vergaß ich mein lebelang nicht.« Mit diesen Worten schien Herr Lindow seine ErzÄhlung »Oh,« antwortete er ihr in scheinbar gleichgÜltigem Tone, »es ist die Geschichte von dem berÜhmten Kuß am Gartentor!« »Ach du!« sagte Frau Lindow. »Ja, das kommt davon, wenn man sich mit Verbrechern einlÄßt.« Mir ging plÖtzlich ein Licht auf, entzÜndet an dem schimmernden Glanze der Augen, mit dem die beiden alten Leute einander ansahen. »Alte,« rief der Doktor, »denkst du daran, daß es jetzt gerade vierzig Jahre sind seit jenem verhÄngnisvollen Kuß? Komm, laß uns anstoßen auf ein glÜckliches Alter!« Wir erhoben uns, und die GlÄser klangen aneinander. Dann kÜßten die beiden Alten sich, und ein Abglanz wie von ewiger Jugend verklÄrte ihre glÜcklichen Gesichter. Heinrich Seidel. |
|
|